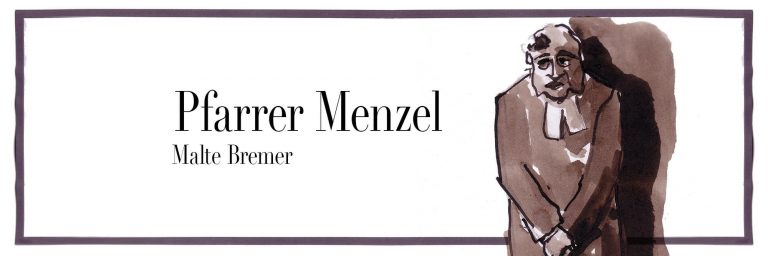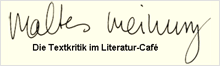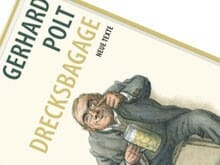Einmal betrat Pfarrer Menzel eingedenk seiner gut vorbereiteten Predigt frohen Schrittes die Stufen zur Kanzel, erreichte die Galerie, breitete seine Erinnerungszettel aus, bannte seine Gemeinde festen Blicks und musste bestürzt feststellen, dass er das Haushaltsbuch seiner Haushaltshälterin aufgeschlagen in den Händen hielt. Flugs und geistesgegenwärtig kündigte er das Absingen von Lied 466, Verse 1 bis 7 an, fand aber trotz allem seine Predigtkladde nicht wieder. Seine anschließenden Ausführungen über das Haushaltsbuch sind als ursächlich zu betrachten für die Kündigung seiner Haushaltshälterin. Seitdem ist es immer schlimmer geworden.
Gesammelte Erzählungen über Pfarrer Menzel von Malte Bremer

Am 31. März 2008 startete wieder ein literarisches Projekt mit Fortsetzungen im literaturcafe.de. Täglich konnten Sie im literaturcafe.de eine kleine Geschichte über Pfarrer Menzel lesen. Der Autor ist den Gästen des literaturcafe.de natürlich bestens bekannt, obwohl er ansonsten eher auf der anderen Seite sitzt: Unser Textkritiker Malte Bremer schreibt selbst.
Geschrieben wurden die Geschichten allerdings bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bei verschiedensten Gelegenheiten: als Ver- und Bearbeitung von Gehörtem, Gesehenem, Gefühltem, Gerochenem, Gelesenem, Gedachtem und Geträumtem. Und Geklautem. Es ist sogar eine regelrechte Auftragsarbeit dabei für einen Vorleser (nein: nicht Wolfgang Tischer), der seit den 90ern immer wieder aus dieser Sammlung liest.
Eine Druckvorlage wurde damals mit Calamus auf dem Atari gesetzt, und 20 Exemplare wurden in einem Copyshop hergestellt und nach und nach an Freunde und Familie verschenkt.
Nach all den Jahren sind sie frisch überarbeitet von März bis Juli 2008 exklusiv täglich im literaturcafe.de erschienen. Jetzt können Sie hier alle Folgen lesen.
Ab sofort ist die Sammlung auch als als E-Book bei Amazon erhältlich.
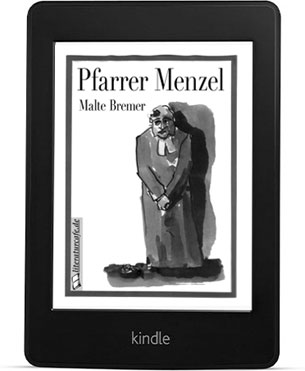
Maltes Meinung: Erzählen statt Moralkeulen schwingen
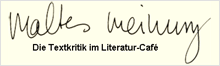 »Zeit für Jim« heißt die Geschichte, die Malte Bremer diesmal für seine Textkritik ausgesucht hat. Und obwohl Malte im Detail sehr viele Anmerkungen hat, darf man daraus nicht automatisch schließen, dass das Prosawerk schlecht sei. Im Gegenteil: Vier von fünf Brillen vergibt unser Textkritiker.
»Zeit für Jim« heißt die Geschichte, die Malte Bremer diesmal für seine Textkritik ausgesucht hat. Und obwohl Malte im Detail sehr viele Anmerkungen hat, darf man daraus nicht automatisch schließen, dass das Prosawerk schlecht sei. Im Gegenteil: Vier von fünf Brillen vergibt unser Textkritiker.
Wir zitieren aus Malte Bremers Zusammenfassung: »Schön, dass es noch Menschen gibt, die etwas zu erzählen haben, statt Moralkeulen zu schwingen. Hier ist ein wunderbar leise Geschichte, die sich Zeit lässt, eine Freundschaft zu schildern, und sich allmählich dramatisch steigert.«
Textkritik: Zeit für Jim – Prosa
Heute war Sonntag. In orangeroten Farben ergoss sich die Dämmerung über das Land, während ich hier allein im Tower eines kleines Flughafens für Sport- und Segelflugzeuge saß und die Kreise meines Freundes am Himmel beobachtete. Einst wuchsen wir gemeinsam auf, besuchten dieselbe Schule und teilten all die Zeit sogar das Faible für Flugzeuge. Doch während er einen Flugschein machte und als Ingenieur bei einem großen europäischen Flugzeugbetrieb arbeitete, wurde ich nur Fluglotse. Nun brummte seine einmotorige, weiße Cessna in der Ferne und er zog weitere Spiralen am Himmel . Alle meine Kollegen waren längst zuhause und auch ich wartete nur auf die Nachtschicht, die mich ablösen würde. Ich schmunzelte und beugte mich über das Mikrofon.
»Tower an Cessna-237-weiß, wie sieht es dort oben aus, Jim?«
Da keine weitere Maschine auf dem Radar war, konnte ich mir einen kleinen Plausch leisten.
Nach einigen Momenten hörte ich seine vertraute Stimme. Sie erinnerte wie immer an einen dickbäuchigen Seebären, etwas rauchig, aber freundlich.
»Mhmh, ich seh‘ mir gerade die Bundesstraße an.« , murmelte Jim.
»Die Bundesstraße, Jim? Sag bloß, ich werde nachher Stau haben …«
Ein leises Lachen ertönte.
»Nein, nein … ich sehe nur dem bunten Treiben zu. Die Menschen sind manchmal ruhelos, findest Du nicht? Immer vorwärts, niemals zurücksehen.«
Ich sah, wie sich die Cessna auf eine Seite legte. So konnte Jim offenbar besser herabschauen.
Ich zuckte mit den Schultern, ehe mir einfiel, dass Jim mich nicht sehen konnte. »Die wollen nur wie ich nach Hause. Einfach Zeit bei ihrer Familie verbringen.«
»Mh…«, dann Schweigen. Mir tat der Satz gleich leid, da Jim keine Familie hatte. Aber oft kam er am Wochenende zu Besuch. Gerne erzählte er meinen kleinen Kindern Flugabenteuer. Natürlich waren keine davon wahr, aber die Kleinen begeisterte ihr echter Geschichtenonkel. Sie nannten ihn sogar ›Onkel Jim‹, obwohl er kein Verwandter, sondern nur ein Freund der Familie war.
Jim sprach dann überraschend weiter.
»Wie fand Becci ihren Geburtstag?«
Offenbar hatte ich das Thema ungewollt auf meine Familie gelenkt.
Becci war zehn Jahre alt und damit meine älteste Tochter. Vor drei Tagen hatten wir ihren Geburtstag gefeiert. Einen richtigen Kindergeburtstag: mit Eis, Kuchen, bunten Luftballons und Geschichten von ›Onkel Jim‹.
»Du warst doch dabei, Jim. Sie strahlte vor Freude.«
»Deine Tochter strahlt immer.«
Ich zögerte und tippte unschlüssig mit Fingern auf das Armaturenbrett das Radars.
»Wie meinst du das, Jim?«.
Ich wusste schließlich nicht genau, auf was er hinauswollte.
»Ich bewundere Deine Kinder. Du hast sie ganz nach deinem Leben aufgezogen. Sie genießen jeden Tag und sind die meiste Zeit davon glücklich.« Jim zögerte und begann eine Wendeschleife zu fliegen, ehe er raunend fortfuhr: »Weißt du, bei mir hat es eine Weile gedauert. Damals, als ich noch klein war, nun … da habe ich mich das ganze Jahr auf den Tag gefreut, an dem ich glücklich sein durfte. Den Geburtstag. Ein Tag von 356. Eigenartig, mh?«
Ich dachte darüber nach, kam aber zu keinem Ergebnis, dass mich zufrieden stellte.
»Man war ein Kind. Da fehlte einem die Einsicht, die mit dem Erwachsenwerden kommt.«, erwiderte ich ihm.
Jim lachte leise und ich sah zu seinem Flugzeug, das nur noch als ein kleiner, glitzernder Punkt am Horizont funkelte. Die Tragflächen konnte man nur erraten.
»Ich habe also nichts dazugelernt.«, brummte Jim.
»Wieso?«
»Weil du Recht hast.«
»Was hat das denn mit dir zu tun?«
Auf den Radar verfolgte ich Jims Näherkommen. Gut so. Er müsste nämlich bald landen. Jim war schon den gesamten Nachmittag geflogen und irgendwann würde sein Tank leer sein. Ich sah durch die Fensterscheiben abermals zum Himmel und betrachtete das feuerrote Schauspiel der Dämmerung. Jims ratternde Cessna darin wurde sekündlich deutlicher.
»Ganz einfach«, meinte Jim, »Wochenende für Wochenende erkaufe ich mir sechs Stunden Freiheit im Himmel und fühle mich glücklich, während du einfach jeden Tag für dich gewinnst, indem du nach Hause fährst.« Jim hatte es nicht wie einen Vorwurf formuliert, und trotzdem rutschte ich unbehaglich auf meinem Sessel hin und her.
»Dafür fliegst du frei wie ein Vogel, Jim.«
»Stimmt.«
Eine Weile antwortete er nicht. Positionslichter flackerten an den Tragflächenspitzen seines Flugzeuges auf. Das war Vorschrift, denn es legte sich schließlich schon ein Hauch Nacht auf die Welt.
Nur Jims vom Licht vergoldete Cessna glühte unverändert am Himmel und folgte treu seinen Ruderbewegungen.
»Du solltest es sehen«, meinte er plötzlich zu mir, »der Sonnenuntergang. Er ist wunderschön.«
Ein leises Fiepen im Lautsprecher, das offenbar aus Jims Flugzeug stammte, fesselte meine Aufmerksam mehr als den Himmel. Alarmiert rückte ich näher zum Radar und Mikrofon.
»Jim? Alles okay?«
»Mh? Ja.«
Eine kurze Pause.
»Was ist das für ein Signal?«
»Ach… die Treibstoffwarnung.«
Ich prüfte seine Koordinaten und ermittelte somit seine Position im Verhältnis zum Flughafen.
»Wieviel Treibstoff hast du denn noch?«
Er sagte es mir ohne zu zögern und ich war erleichtert. Es sollte noch ausreichen.
»Na, komm lieber runter und heim«, schmunzelte ich und prüfte, ob die Landebahnen frei waren.
»Lass mir noch eine Runde. Es sieht so wunderschön aus.«
Ich tippe abermals unschlüssig auf die Amaturenseite, denn ehrlich gesagt machte mich das schrille Signalfiepen aus Jims Flugzeug ziemlich nervös. Trotzdem gönnte ich ihm diesen Moment gern. »In Ordnung. Eine Runde. Deine Landebahn ist dann drei.«
Sein Flugzeug sah von hier unten spielzeughaft aus. Am wolkenlosen Abendhimmel lärmte das stetige Motorgeräusch und ich überlegte, ob die Flugaufsichtsbehörde Ärger machen würde, wenn Jim noch länger oben blieb.
»Jim? Es wird Zeit.«
Eine Weile folgte Schweigen, das nur durch ein auf und ab schwellendes Fiepen unterbrochen wurde.
»Ich möchte nicht zurückkehren. Sieh es dir nur an. Ich kann noch nicht wegsehen.«
»Jim, es ist spät.«
»Ich kann nicht wegsehen.«
»Jim!« ,rief ich, aber Jim antwortete nicht. Der Wind kam mit stetigen Böen aus dem Osten und schob sein Flugzeug zügig fort.
»Höre zu, Jim. Ich gebe dir Rollbahn 1 und mach‘ die Landelichter an.«
Rollbahn 1 war eigentlich für kleine Frachtmaschinen gedacht. Als größte Start- und Landebahn unseres Flughafens war sie viel zu üppig für Sportmaschinen, aber es machte Spaß darauf zu landen und ich wollte Jim locken, wollte ihn am Boden wissen.
»Jim?«
Inzwischen legte ich entsprechende Schalter um. Rhythmisch flammten die Landeleuchten auf und zeigten den Weg.
Endlich flog Jim einen Halbkreis und ich atmete erleichtert auf, als sein Flugzeug langsam wieder in meine Richtung zeigte. Doch, wie ich bald bemerkte, hielt er nicht inne, sondern begann nur weitere Spiralen zu fliegen.
»Jim? Willst du irgendwas ausprobieren? Es ist ganz einfach, du …«, rief ich in das Mikrofon, bevor Jims Cessnamotor hörbar stotterte und mich unterbrach. Stille.
Lautlos glitt Jims Flugzeug durch den Nachthimmel.
»Tower an Cessna-237-weiß. Hörst du mich, Jim?”
»Ja.«. Seine Stimme flatterte etwas und ich hörte Jims Atem. Offenbar ging es ihm nicht gut.
»Hör mir zu.«
»Ja.«
»Der Wind ist zu stark und dir bleibt nicht genug Zeit, um den Flughafen zu erreichen.«
»Ja.«
Nickend nahm ich mit der linken Hand meine Flugkarte zur Hand. Sie erinnerte grob an eine Landkarte, doch war sie mit eingezeichneten Fluglinien, Flughäfen, Landeschneisen und anderen wichtige Informationen entstellt.
»Okay, Jim. Sieh nach rechts. 3 Uhr und etwa einen Kilometer entfernt. Da ist ein großes Feld, wahrscheinlich Raps.
»Ja, ich sehe es.«
Ein dünner Schweißfilm bildete sich auf meiner Stirn und ich prüfte die Karte, doch es müsste klappen.
»Gut, da kannst du bequem hinsegeln.«, rief ich und atmete tief durch, »und landen.«
Noch immer funkelte Jims Flugzeug im Abendlicht und hörte nicht mit dem Kreisen auf.
»Nein, ich will dort nicht landen.«
Meine Hand krallte sich das Mikrofon und ich beobachtete mit dem Radar, wie Jims Flugzeug die Höhe beibehielt, anstatt tiefer zu segeln. Er wurde immer langsamer.
»Jim! Unter dir ist überall Wald! du kannst nirgendwo sonst landen!«
»Wenn ich die Maschine schrotte, werden sie mir den Flugschein wegnehmen.« Jim klang, als wäre er sonderbar ruhig, ich dagegen war vollkommen aufgewühlt.
»Das kann unmöglich dein Grund sein, oben zu bleiben!«
Jims belegtes Lachen ließ mich erschaudern. Wenn er nicht bald segelte, würde die Maschine zu langsam werden. Die Tragflächen würden einen Strömungsabriss erleiden und er und sein Flugzeug fielen wie ein Stein vom Himmel. Nein, mir verging bei dieser Voraussicht jeglicher Humor.
»Gut, ich bin ehrlich.«, begann Jim in einen Tonfall, als wolle er meinen Kindern eine Geschichte erzählen. »Du sagtest, ich soll heim kommen. Hier oben, mein Freund, hier oben, wenn ich die Zeit in der Luft verbringe, hier oben bin ich zuhause.« Jims Stimme pausierte, ehe er betont weiter sprach. »Verstehst du, mein Freund? Hier bin ich frei! Frei wie ein Vogel. Nur im Flugzeug weiß man, wie die Vögel den Sonnenuntergang erleben. Wie die Nacht die hektische Welt des Bodens einfach ausblendet. Hier gibt es nur noch Himmel, Licht und Sonne. Hier will ich bleiben.«
Das Mikrofon knackte, als Jim den Funk unterbrach. Bleich vor Schreck beobachtete ich, wie Jims Flugzeug zwei Minuten später vom Radar verschwand.
Zusammenfassende Bewertung
Schön, dass es noch Menschen gibt, die etwas zu erzählen haben, statt Moralkeulen zu schwingen. Hier ist ein wunderbar leise Geschichte, die sich Zeit lässt, eine Freundschaft zu schildern, und sich allmählich dramatisch steigert.
Trotz der vielen Anmerkungen bleibt das eine gute Geschichte; die Fehler sind die üblichen, die jedem beim Schreiben widerfahren und leicht zu korrigieren sind, selbst die Kitschandeutungen lassen sich problemlos entfernen.
Die Kritik im Einzelnen
Wie wäre es mit einem einfachen Orangerot ergoss sich …? Eben! zurück
…über das Land kann problemlos getilgt werden, da unverzüglich angeschlossen wird, dass er im Tower sitzt; er muss auch nicht hier im Tower sitzen, da der Standort des Towers präzisiert wird; ein Flughafen für Sport- und Segelflugzeuge ist notwendig klein, dieses Adjektiv verliert deswegen seine Daseinsberechtigung. Da kein konkreter Ort angegeben ist, ist der Flughafen ausreichend anonym, deswegen wäre es logisch, eines Flughafens in des Flughafens zu ändern (ist aber nicht lebenswichtig): Orangerot ergoss sich die Dämmerung, während ich allein im Tower des Flughafens für Sport- und Segelflugzeuge saß und … zurück
Macht man nicht seinen Fugschein, so wie jeder auch seinen Führerschein macht und nicht irgendeinen? zurück
Wir wissen bereits, dass des Erzähler-Ich allein ist, und dass es Kollegen gibt, erfahren wir anlässlich der Warterei. Auch all diese Wörter ab Satzbeginn gehören huschhusch in den Papierkorb! zurück
Da der Anfang des Satzes gestrichen wurde, muss die Überleitung anders sein, Z. B. … er zog weitere Spiralen am Himmel, während ich auf die Nachtschicht wartete, die mich ablösen sollte. Er kann nicht auch warten, denn er ist allein, und er wartet nicht nur, sondern funkt seinen Freund an! zurück
Aus welchem Grund schmunzelt er hier? Hat er einen Fliegerwitz in petto, den sein Freund da oben noch nicht kennt? Will er mit ihm über gemeinsame Schulstreiche oder erste Anbändelversuche plaudern à la »Weißt du noch, wie wir damals …«? Ich fände es um Klassen besser, wenn er sich einfach nur über das Mikrofon beugt, schließlich muss er a) die Zeit bis zur Ablösung irgendwie klein kriegen und b) hatte er sich gerade an seinen Freund erinnert. zurück
Das Anredefürwort du wird nur in Briefen bzw. persönlichen Mitteilungen groß geschrieben – sofern man es will (so will es die Rechtschreibreform). Alle anderen Dus und Dichs werde ich ab hier ohne weiteren Hinweis im Originaltext korrigieren. zurück
Dieses ganz ist zu umgangssprachlich: sofort zurück
Was ist ein falscher Gechichtenonkel? Wozu dient das Adjektiv echter? Also weg damit, wegwegweg! zurück
Dieser Satz kann komplett gestrichen werden, denn die nächste Frage kommt problemlos ohne diese »Erläuterung« aus. zurück
Das verstehe ich: Ist hier Lebensart gemeint? Lebensvorstellung? Lebenseinstellung? Ganz allgemein Vorstellungen? Aber gewiss nicht: nach deinem Leben… zurück
So wenig, wie der Ich-Erzähler einen Grund zum Schmunzeln hatte, so wenig finde ich einen Grund für Jims Raunen! zurück
Wer im Tower sitz, hat rundum Fensterscheiben; sollte er also den Blick vom Radarschirm heben, schaut er notgedrungen durch Fensterscheiben. In den Himmel muss er nicht blicken, denn in einem Tower muss man sich schon gewaltig anstrengen, den Himmel nicht zu sehen! Und da die Dämmerung sich bekanntermaßen irgendwie am Himmel abspielt, wird kein Leser davon ausgehen, dass unser Protagonist sie in der Schublade betrachtet. Fassen wir deshalb zusammen: Ich betrachtete das feuerrote Schauspiel der Dämmerung (Hach, wie ich sie liebe, diese Streichungen!) zurück
Hm: Verwenden Flieger tatsächlich dieses breitgekaute Klischee? Reicht es für den Protagonisten nicht, dass Jim seinen Flugschein hat, während er lediglich im Tower sitzen darf? Genügte dem nicht ein einfaches »Dafür fliegst du!«? Denn selbst, wenn Flieger dieses alberne Klischee auf ihre Wimpel geschrieben haben sollten, gibt es keinen Grund, selbiges in einem literarischen Text zu benutzen. zurück
Wen oder was sollte sich der Protagonist betrachten? Richtig: den Sonnenuntergang! zurück
Wieso sollte das Fiepen den Himmel fesseln? Hier muss es jetzt der Himmel lauten – als Ausgleich und Austausch zum vorigen falschen Fall. zurück
Wiederum nur eine Kleinigkeit: Ich würde aus zum ein zu machen, weil hier die eigentliche Tätigkeit des Fluglotsen gemeint ist. zurück
Nanana, schon wieder schmunzelt unser Protagonist völlig unmotiviert! Warum die Scheu vor einem einfachen »sagte«? Diese Erzählung lebt von ihrer Ruhe, obwohl man sehr wohl merkt, dass etwas nicht stimmt. Da bedarf es keiner speziellen, launigen Umschreibungen; vielleicht ließe sich der Inhalt betonen: »Na, komm lieber runter und heim«, forderte ich ihn auf und prüfte… zurück
Das geht nicht, er hat noch nie auf die Armaturenseite geklopft: es war das Armaturenbrett gewesen, und so soll es auch bleiben. zurück
Wir wissen: er unten, Jim oben! Warum das erneut in Leserschädel keilen? Und spielzeughaft ist ein unschönes Wortgebilde, erinnert es doch an Einzelhaft. Vorschlag: Sein Flugzeug wirkte wie ein Spielzeug. zurück
Wir wissen jetzt, was das für ein Piepen ist, also ist es nicht mehr ein Piepen, sondern das Piepen. zurück
Böen treten plötzlich auf, können also nicht stetig sein; gemeint wist wohl: immer wiederkehrende. zurück
Da stottert gewiss nicht Jims Cessnamotor, den hat er nämlich gar nicht, sondern der der Cessna, wie der Name schon sagt; außerdem bezweifle ich, dass der Ich-Erzähler noch einen anderen Motor über Funk hören kann als den von Jims Cessna! Also: bevor der Motor hörbar stotterte …zurück
Zweimal Hand in einem Satz, obwohl es ganz ohne geht: Denn womit nimmt man etwas (sofern man sie hat)? So könnte es gehen: Nickend nahm ich mit der Linken die Flugkarte. zurück
Meines Wissens wird die Flughöhe auf dem Radarschirm angezeigt; wenn dem so ist, müsste es auf dem Radar heißen (statt mit). zurück
Es ist keine Voraussicht, sondern die realistische Aussicht: es gibt keine anderen Aussichten mehr. zurück
Wegen des hervorquellenden Kitsches bitte ich ganz dringend darum, ab hier den Rest des Absatzes (mit Ausnahme des letzten Satzes!) rückstandslos zu eliminieren! Die Wiederholung der Vogelfrei-Plattitüde, das Hektische-Welt-Klischee und die dümmliche Feststellung, im Himmel sei immer Licht und Sonne – nein: das tut der Erzählung gar nicht gut, das hat sie auch nicht verdient! Übrig bliebe dann Folgendes, und jeder möge prüfen, ob etwas Wichtiges fehlt:
[…] Hier oben, mein Freund, hier oben, wenn ich die Zeit in der Luft verbringe, hier oben bin ich zuhause.« Jims Stimme pausierte, ehe er betont weitersprach. »Verstehst Du, mein Freund? Hier bin ich frei! Hier will ich bleiben.« zurück
Ich bitte nicht weniger dringend um die Streichung des letzten Satzes. Warum dem Leser seine eigenen Gefühle nehmen, ihn stattdessen mit denen des Protagonisten zuschütten? zurück
Zu Gast bei Paulo Coelho in Paris – Ein Bericht in zwei Teilen – Teil 2
 Fortsetzung von Teil1: Aus meiner Tasche krame ich nochmals den Plan heraus, den mir Paulo Coelhos Assistentin Paula geschickt hat, um den Namen des Bootes herauszufinden, auf dem die Party des brasilianischen Autors stattfinden soll. Es legen hier an diesem Abend einige Boote zu privaten Festen ab. Es sind die typischen länglichen Ausflugsboote, flach genug, um unter den Brücken der französischen Hauptstadt hindurchzupassen.
Fortsetzung von Teil1: Aus meiner Tasche krame ich nochmals den Plan heraus, den mir Paulo Coelhos Assistentin Paula geschickt hat, um den Namen des Bootes herauszufinden, auf dem die Party des brasilianischen Autors stattfinden soll. Es legen hier an diesem Abend einige Boote zu privaten Festen ab. Es sind die typischen länglichen Ausflugsboote, flach genug, um unter den Brücken der französischen Hauptstadt hindurchzupassen.
Ich erreiche die »Zouave«. Es hat erneut zu regnen begonnen, und vor der Gangway zum Boot stehen zwei Mädels. Die eine mit Gästeliste, die andere hält einen Regenschirm. Die mit der Liste ist Paula, die mich herzlich begrüßt.
Ich betrete das Boot. Der Eingangsbereich ist mit rotem Teppich ausgelegt. An der verglasten Bugfront laden bequeme Sessel zum Verweilen ein. Rechts die Garderobe. Ein schwimmender Veranstaltungssaal.
Beim Anblick der ersten Gäste bin reichlich erstaunt. So sehen die Leser aus, die Paulo Coelho über das Internet eingeladen hat? Ich hätte ein Durchschnittsalter von 25 erwartet, doch die hier sind mindestens doppelt so alt.
Zu Gast bei Paulo Coelho in Paris – Ein Bericht in zwei Teilen – Teil 1
 Mittwoch, 19. März 2008. Neben mir am Stuttgarter Flughafen steht die Tanja-Anja einer PR-Agentur. Sie müsse heute Abend in Paris auf diese »scheiß Party«, schreit sie in ihr Mobiltelefon. Kann es sein, dass sie die Party von Paulo Coelho meint? Ausgeschlossen!
Mittwoch, 19. März 2008. Neben mir am Stuttgarter Flughafen steht die Tanja-Anja einer PR-Agentur. Sie müsse heute Abend in Paris auf diese »scheiß Party«, schreit sie in ihr Mobiltelefon. Kann es sein, dass sie die Party von Paulo Coelho meint? Ausgeschlossen!
Der Bestseller-Autor hat über 100 Leser aus aller Welt zu einer Feier auf ein Boot auf der Seine eingeladen. »Wir hatten heute Mittag noch eine Präsentation bei Hugo Boss«, schreit ihr Begleiter ins Telefon, »und sind jetzt auf dem Weg nach Paris, wo Paulo Coelho eine Party gibt.« Also doch.
Der weitere Wortwechsel bleibt unerfreulich, und ich bin erleichtert, im Flugzeug weiter vorn zu sitzen, zwischen Franzosen, deren Worte ich nicht verstehe. Manchmal ist das gut.
Im Flugzeug lese ich den Anfang von »Der Alchemist«. Es ist Coelhos weltweit mit mehr als 8 Millionen Exemplaren meistverkauftes Buch. Die Tage davor habe ich mich an seinem aktuellen Werk »Die Hexe von Portobello« versucht, doch irgendwie bin ich mit dem Text nicht zurechtgekommen oder der Text nicht mit mir.
Wie die Tanja-Anja bin ich also eigentlich kein Coelho-Leser, aber im Unterschied zu ihr freue ich mich auf die Veranstaltung heute Abend.
Gegen alle Tabus: »Feuchtgebiete« von Charlotte Roche
 Helen Memel ist spektakulär. Helen ist 18 und hat einen roten Riesenpo, aus dem Hämorrhoiden und eine Wundblase heraushängen, und zwar so, dass jeder es sieht – seit sie nach einer missglückten Intimrasur seitwärts im Krankenhausbett liegt und auf ihre Operation wartet.
Helen Memel ist spektakulär. Helen ist 18 und hat einen roten Riesenpo, aus dem Hämorrhoiden und eine Wundblase heraushängen, und zwar so, dass jeder es sieht – seit sie nach einer missglückten Intimrasur seitwärts im Krankenhausbett liegt und auf ihre Operation wartet.
So kauert sie im Hospital und lenkt sich ab von ihrer Angst vor der OP. Es kommt der Pfleger Robin, es folgen OP und Schmerzen, die Heilung, dann noch eine OP und zwischendurch Besuch von Mama, von Papa sowie jede Menge absolut laut gedachter Gedanken und Spleens rund um Sex und Körperlichkeit. Um genau zu sein, geht es um »Kackeschwitzen«, Muschischleim, trüffeligen Smegmageschmack & Co.
Der Handlungsort des Romans ist das Krankenhaus, ein Ort, an dem per se jeder Mensch auf seine körperlichen Vorgänge heruntergebrochen wird – von außen, also seitens des Klinikpersonals, wie von innen, d.h. in Hinsicht auf Angst, Scham und widerwillige Kooperation: Offenbarung der Regelmäßigkeit des Stuhlgangs. Das psychologische Gerüst der Geschichte fußt auf Helens irrwitzigem Glauben, sie könne durch ihre Arsch-OP ihre geschiedenen Eltern am Krankenhausbett wieder vereinen – des Scheidungskindes sehnlichster, zarter Wunsch.
Selbstbefriedigung vor dem Bildschirm: Texte von Männern gesucht
 Da hier in wenigen Stunden die Buchrezension zu Charlotte Roches erstem Roman »Feuchtgebiete« zu lesen sein wird, stimmen wir uns schon mal auf den Themenbereich ein und leiten folgenden Aufruf des Linksbuch-Forums weiter:
Da hier in wenigen Stunden die Buchrezension zu Charlotte Roches erstem Roman »Feuchtgebiete« zu lesen sein wird, stimmen wir uns schon mal auf den Themenbereich ein und leiten folgenden Aufruf des Linksbuch-Forums weiter:
Dieser Projektaufruf richtet sich an Männer! Im Internet ist es für Männer ein Leichtes, pornografische Seiten aufzurufen und diese als Vorlage zur Selbstbefriedigung zu nutzen. Der Weg in die Sucht ist durch derartige Angebote vorgezeichnet: Die schnelle Lustbefriedigung wird zum täglichen Ritual mit allen daraus sich ergebenden negativen Folgeerscheinungen wie Abhängigkeit, zunehmende Vereinsamung, Störung bzw. Zerstörung intimer Beziehungen zur Partnerin. Unter dem Arbeitstitel „Die Einsamkeit des Wichsens“ werden Erfahrungsberichte von männlichen Autoren gesucht, die das eigene diesbezügliche Erleben und die daraus resultierenden Erfahrungen und Probleme ehrlich und offen darstellen. Die Wahrung der Anonymität der Teilnehmer wird zugesichert. Manuskriptzusendungen im Umfang von mindestens 10.000 Zeichen als Word-Datei über die Kontaktseite von www.linksbuch-forum.de erbeten. Einsendeschluß für Beiträge ist der 1. Juli 2008.
Eine Frage jedoch: Warum geht man das Thema denn schon von vornherein voreingenommen negativ an?
Unbedingter Lesebefehl: Autorenverzweiflung und Graupelgewitter
 Gerade aus unseren Links gefischt haben wir noch einen wunderbaren Bericht über die Leipziger Buchmesse 2008. Ein Text so herrlich subjektiv und doch so treffend, dass wie Sie hiermit auffordern, sofort diesen Link hier anzuklicken und das dokumentarische Textjuwel zu lesen – auch wenn es sprachlich bei Weitem keines ist. Halten Sie durch!
Gerade aus unseren Links gefischt haben wir noch einen wunderbaren Bericht über die Leipziger Buchmesse 2008. Ein Text so herrlich subjektiv und doch so treffend, dass wie Sie hiermit auffordern, sofort diesen Link hier anzuklicken und das dokumentarische Textjuwel zu lesen – auch wenn es sprachlich bei Weitem keines ist. Halten Sie durch!
Hey! Sie lesen hier ja immer noch weiter! Hatten wir nicht gesagt, Sie müssen einfach diesen Link anklicken und den Text lesen? Achso, Sie klicken erst, nachdem Sie hier alles gelesen haben.
Nun, dann sei noch festgestellt, dass das zuckerbrot-Blog, das, wie wir auf der ICH-Seite lesen, eigentlich keines ist, sondern »nur eine Seite, wo ich so Sachen schreibe und zeige« auch sonst eine feine Auswahl an Bildern, Kommentaren, Hinweisen, Links und Texten präsentiert. Zum Beispiel die »fürchterlichen Wörter«. Aktuell vom 17.03.2008: Graupelgewitter.
So, jetzt aber klicken!
China als Gastland der Buchmesse: Wie viele Tote sind erlaubt?
 Anlässlich der Vorgänge in Tibet gerät auch die Gastland-Präsentation Chinas bei der Frankfurter Buchmesse wieder in die Diskussion. 2009 soll sich das asiatische Land auf der Bücherschau darstellen. Darf die Kultur- und Wirtschaftsmesse die Plattform für die Präsentation eines diktatorischen Landes sein, das Andersdenkende blutig niederknüppelt, 1989 beim Tian’anmen-Massaker und aktuell in Tibet?
Anlässlich der Vorgänge in Tibet gerät auch die Gastland-Präsentation Chinas bei der Frankfurter Buchmesse wieder in die Diskussion. 2009 soll sich das asiatische Land auf der Bücherschau darstellen. Darf die Kultur- und Wirtschaftsmesse die Plattform für die Präsentation eines diktatorischen Landes sein, das Andersdenkende blutig niederknüppelt, 1989 beim Tian’anmen-Massaker und aktuell in Tibet?
Bereits im Herbst des letzten Jahres haben wir Buchmessedirektor Jürgen Boos die Frage hinsichtlich der Zensur in China gestellt. »Mit Gästen spricht man durchaus auch über unangenehme Themen«, so Boos damals.
Uwe Wittstock stellt in seinem Kommentar in der WELT die Frage, wie weit dieser Dialog gehen soll. Wittstock: Aber bis zu welcher Grenze, bis zu welcher Zahl von Toten gilt dieses Argument? Werden sich beim Ehrengastauftritt Chinas tatsächlich nicht pekingtreue Tibeter präsentieren dürfen? Oder wird die Buchmesse 2009 eine prächtige Bühne sein für Diktatoren, die bei der Niederschlagung von Regimegegnern vor kaum etwas zurückschrecken?
Die Fragen bleiben einstweilen offen. Vielleicht sind ja bis 2009 die Vorfälle in Tibet auch wieder vergessen.
Drecksbagage: Gerhard Polt signiert im Internet
 Nicht immer sollte man Bücher sofort bei Amazon & Co. bestellen. Manchmal lohnt sich der Blick auf die Verlagswebsite. Der Schweizer Verlag Kein & Aber, der seit der Neugestaltung seiner Website bereits mit einem netten Hörbuchradio aufwartet, lädt regelmäßig zur Online-Signierstunde. Die Umsetzung ist einfach, jedoch für Fans des jeweiligen Autoren lohnenswert: Neben der eigenen Adresse gibt man auf der Verlagswebsite einen kurzen Widmungstext ein, den der Autor dann persönlich von Hand ins Buch schreibt.
Nicht immer sollte man Bücher sofort bei Amazon & Co. bestellen. Manchmal lohnt sich der Blick auf die Verlagswebsite. Der Schweizer Verlag Kein & Aber, der seit der Neugestaltung seiner Website bereits mit einem netten Hörbuchradio aufwartet, lädt regelmäßig zur Online-Signierstunde. Die Umsetzung ist einfach, jedoch für Fans des jeweiligen Autoren lohnenswert: Neben der eigenen Adresse gibt man auf der Verlagswebsite einen kurzen Widmungstext ein, den der Autor dann persönlich von Hand ins Buch schreibt.
Aktuell signiert seit gestern kein geringerer als Kabarett-Großmeister Gerhard Polt sein Buch Drecksbagage »online«. Bis zum Versand des persönlichen Exemplars muss man sich jedoch gedulden: erst Anfang Mai ist der Meister offenbar wieder mal beim Verlag in Zürich zu Gast. Zum Buchpreis von 12 Euro 90 kommen 5 Euro Versand- und Verpackungskosten. Dafür verschickt der Verlag das Buch vertrauensvoll mit Rechnung.
Vor Polt signierten bereits Philipp Tingler und Konstantin Richter. Noch hält sich laut Verlag die Resonanz auf die virtuelle Signierstunde in Grenzen. Zwar wird auf der Startseite darauf hingewiesen, jedoch wird der signierende Autor nicht genannt. Bei Polt dürfte der Promi-Faktor und der Wunsch nach einer persönlichen Widmung natürlich höher sein. Man sieht ihn schon förmlich im Lagerraum des Verlages fluchend mit Füllfederhalter zwischen Büchertürmen sitzen.
Literaturkanal lettra ist insolvent
 Ach herrje, das ging ja schnell. Im November startete der reine Literaturkanal lettra. Kein halbes Jahr später ist der Spartensender insolvent, wie Kress meldet. Laut Kress sei der Sender überschuldet, Dienstleister mussten Monate auf ihr Geld warten. Noch wird der Sendebetrieb aufrecht erhalten, nach einem Investor wird gesucht.
Ach herrje, das ging ja schnell. Im November startete der reine Literaturkanal lettra. Kein halbes Jahr später ist der Spartensender insolvent, wie Kress meldet. Laut Kress sei der Sender überschuldet, Dienstleister mussten Monate auf ihr Geld warten. Noch wird der Sendebetrieb aufrecht erhalten, nach einem Investor wird gesucht.
Leider kann und konnte das Programm nur von ganz wenigen empfangen werden, denn es war ausschließlich im Paket mit anderen Bezahlsendern erhältlich. Und wer sich Pay-TV ins Haus holt, tut dies offenbar nicht wegen der Kultur. Und wo keine Zuschauer, da keine Werbekunden. Der lettra-Trailer, der auf der Website des Senders zu sehen ist, macht keinen schlechten Eindruck. Das sieht durchaus nach einer guten Mischung zwischen Kunst und Unterhaltung aus und kommt absolut professionell daher. Für lettra modiert u.a. das Ehepaar Bärbel Schäfer und Michel Friedman.
Hier bei uns auf dem Schreibtisch liegt noch die Visitenkarte einer netten lettra-Mitarbeiterin, die wir demnächst einmal anrufen wollten. Jetzt heißt es erst mal warten, was aus lettra wird.
Nachtrag: Am 1. April 2008 hat lettra den Sendebetrieb eingestellt.
Kreative Schreibprogramme für MAC und PC – Eine Auswahl
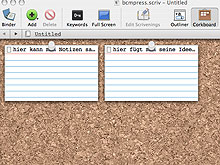 Ideen entstehen zuallererst im Kopf: Texte, Gedichte, Romane. Um sie ins Leben zu rufen, müssen wir auf Handwerkszeug zurückgreifen: Füllfeder, Bleistift, Kugelschreiber, PDA-Stift, Finger, Notizzettel, Kladde, Tagebücher, Bierdeckel, Schreibmaschine, Diktiergeräte. Heute stehen uns zusätzlich eine große Anzahl von Schreibprogrammen zur Verfügung, die uns in unserem kreativen Prozess unterstützen und inspirieren wollen. Inwieweit lässt sich aber der kreative Prozess beeinflussen? Bzw. was hilft uns, was hindert uns? Und gibt es das wirklich: Schreibprogramme, die unserem kreativen Prozess weiterhelfen?
Ideen entstehen zuallererst im Kopf: Texte, Gedichte, Romane. Um sie ins Leben zu rufen, müssen wir auf Handwerkszeug zurückgreifen: Füllfeder, Bleistift, Kugelschreiber, PDA-Stift, Finger, Notizzettel, Kladde, Tagebücher, Bierdeckel, Schreibmaschine, Diktiergeräte. Heute stehen uns zusätzlich eine große Anzahl von Schreibprogrammen zur Verfügung, die uns in unserem kreativen Prozess unterstützen und inspirieren wollen. Inwieweit lässt sich aber der kreative Prozess beeinflussen? Bzw. was hilft uns, was hindert uns? Und gibt es das wirklich: Schreibprogramme, die unserem kreativen Prozess weiterhelfen?
Ich habe entdeckt, dass mir gewisse ästhetische wie auch kreative Elemente beim Schreiben helfen. Natur ist für mich eine unendliche Quelle an Inspiration. Ich liebe den Himmel, Wolken, Sonnenauf- und -untergänge. Meinen Arbeitsplatz habe ich deshalb so eingerichtet, dass ich meinen Blick in die Ferne schweifen lassen kann. In den Himmel und auf die umliegenden Weinberge und Berge der Vogesen und des Schweizer Jura. Nun hat nicht jeder eine schöne Aussicht. In Arbeitsbereichen, in denen ich kein Zimmer mit Aussicht habe, hänge ich mir inspirierende Landschaftsposter an die Wand, oder stelle eine schöne Pflanze auf den Tisch.
Bezahlter Inhalt: Ein Literaturportal wurde zum Bösen verführt
 Derzeit (März 2008) hat der Lübbe-Verlag eine Anzeige im literaturcafe.de für den Titel »Und verführe uns nicht zum Bösen« geschaltet. Das freut uns, denn das Geld von Anzeigenkunden hilft mit, unser Angebot zu finanzieren und auszubauen. Dabei bemühen wir uns, Anzeigen als solche kenntlich zu machen, denn die Verlockung, bezahlte Werbung und redaktionelle Berichte zu vermischen, ist nicht nur bei der »Bild« groß, sondern auch bei vielen Literaturportalen im Netz gängige Praxis.
Derzeit (März 2008) hat der Lübbe-Verlag eine Anzeige im literaturcafe.de für den Titel »Und verführe uns nicht zum Bösen« geschaltet. Das freut uns, denn das Geld von Anzeigenkunden hilft mit, unser Angebot zu finanzieren und auszubauen. Dabei bemühen wir uns, Anzeigen als solche kenntlich zu machen, denn die Verlockung, bezahlte Werbung und redaktionelle Berichte zu vermischen, ist nicht nur bei der »Bild« groß, sondern auch bei vielen Literaturportalen im Netz gängige Praxis.
Ist eine positive Buchbesprechung nur platziert, weil der Verlag dafür Geld bezahlt hat? Wie unauffällig bezahlte Werbung und redaktioneller Inhalt vermischt und Leser getäuscht werden, ist derzeit sehr gut auf dem Angebot literature.de zu sehen. Auf der Startseite findet sich der »Krimitipp«, und für Tipps ist man als Leser ja immer dankbar. Uns hat dieser Tipp jedoch stutzig gemacht, da es genau der Titel ist, den Lübbe derzeit im literaturcafe.de bewirbt. Doch nirgendwo findet sich bei literature.de der Hinweis »Anzeige«. Klickt man auf den Artikel, so fällt auf, dass der »Empfehlungstext« aus den Versatzstücken der Verlagswerbung besteht.
Willms‘ Woche: Intimrasur, Sex und virtuelle Welten
Die Zeiten, in denen Helden zum Mond oder zum Mittelpunkt der Erde reisten, sind längst vorbei. Mit dem Einzug des PCs in den Alltag eroberte ein neues Medium die Literatur: der Cyberspace. Geprägt wurde der Begriff von William Gibson, der 1984 – im Geburtsjahr des Macintosh – den Hacker Case in das virtuelle Abenteuer »Neuromancer« schickte. Der Roman ist der Auftakt zu einer Trilogie, die als Vorreiter des Cyberpunk gilt, eine Art Film Noir der neuen Sci-Fi-Literatur – dunkel, brutal und aussichtslos. Natürlich hat Gibson das Genre nicht neu erfunden, bereits in den 60er Jahren schuf Philip K. Dick mit »Träumen Androiden von elektrischen Schafen?« (aka »Bladerunner«) eine Dystopie von Kultstatus, auf die seitdem viele Cyberpunk-Autoren gerne zurückgreifen. Mit »Neuromancer« beschritt William Gibson, der am 17. März 60 Jahre alt wird, jedoch ganz neue Wege. Menschen, die ihre Nerven mit dem Cyberspace vernetzen – so etwas hatte es in der Form noch nie gegeben. Noch immer liest sich das Abenteuer extrem spannend und schwindelerregend schnell – auch für Computerlaien.
Neue Wege schlägt auch Charlotte Roche ein – neue Wege des Ekels könnte man sagen.