Stefan ging zurück ins Wohnzimmer. Keine seiner bisher aufgestellten Theorien konnte ihn überzeugen. Handtasche und Frauengarderobe ließen sich arrangieren, Erinnerungen konnten selbst Freunde, die sich einen besonders schlechten Scherz ausgedacht hatten und ihn perfekt inszenierten, nicht manipulieren. Bis auf seinen Namen und eine Menge Dinge, die er wie selbstverständlich tat, wusste er nichts über sich. Sogar das Zeitgefühl hatte er über Nacht verloren. Das Fernsehen teilte ihm den Wochentag mit, Samstag. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihn niemand im Büro vermissen würde, war also hoch. Dabei war er sich gar nicht sicher, ob er überhaupt in einem Büro arbeitete.
Halt! Seine persönlichen Papiere könnten ihm Aufschluss geben, die er in zwei blauen Leitz-Ordnern aufbewahrte.
An der Stelle im Schrank klaffte eine Lücke.
Stefan zwang sich zur Ruhe. Für diese Art der Standortbestimmung in seinem Leben musste er systematisch vorgehen. Die bekannten Dinge, auf die er schon gestoßen war, legte er auf den Couchtisch: Ausweis und Führerschein, ein Portemonnaie mit vier Fünfzig-Euro-Scheinen und etwas Kleingeld, eine Scheckkarte. Seine ganze Hoffnung konzentrierte sich auf das kleine Notizbuch aus rotem Leder. In ihm lag vermutlich der Schlüssel zur Außenwelt: Adressen und Telefonnummern.
Stefans Puls beschleunigte sich.
Im Notizbuch fand er weniger Einträge als erwartet und erhofft. Er wählte die Nummer von Melanie.
"Hallo, hier ist Stefan", meldete er sich.
"Ja?" Melanies Stimme blieb kühl.
"Ich bin’s, Stefan", sagte er mit Nachdruck.
"Was wünschen Sie?"
Stefan legte den Hörer auf.
Bei Ulla, Betta, Lisa und Klaus blieb er ebenfalls erfolglos. Nur mit Thomas kam er ins Gespräch. Thomas stellte nach drei Minuten fest, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsste.
Stefan schlug die erste Seite des Notizbuches auf – es gehörte Stefanie Bruhks!
Hab ich sie bei einer Schlamperei ertappt, meinte die Stimme fröhlich.
"Wer hat geschlampt?" fragte Stefan. Die Stimme antwortete nicht.
Stefan zweifelte nicht, dass Notizbuch und der Inhalt des Kleiderschrankes zusammen gehörten. Noch fehlte das Bindeglied, das ihn mit diesen Dingen in Beziehung brachte. In dieser Wohnung lebte nur eine Person, entweder eine Frau oder ein Mann. Er war nicht verheiratet, glaubte er, zumindest kamen ihm bei dieser Überlegung keine Zweifel. Während er in seiner Erinnerung nach einer möglichen Frau forschte, fiel ihm die Lösung zu: Ich bin in der Wohnung meiner Schwester! Warum war er nicht früher auf die Lösung gekommen?
Der Berg, der auf Stefan lastete, bröckelte, doch das befreite Glücksgefühl wollte sich nicht einstellen. Hoffentlich erkennt meine Schwester mich, dachte er skeptisch. Sie war ihm so fremd wie die Namen im Notizbuch. In seinem Bauch ballte sich eine ohnmächtige Wut zusammen.
Ungewöhnlich lange reflektierte ich an dieser Stelle. Ohnmächtige Wut … Stefan sollte nicht toben, ich wollte keine Aggression beschreiben, es gab auch niemandem, den Stefan anschreien konnte. Die Geschichte war noch nicht auf ihrem Höhepunkt und da mussten die Gefühle steigerungsfähig bleiben. Sollte ich Enttäuschung und Verzweiflung beimischen, um die Wut zu dämmen? Teuflisch, sagte ich mir, du denkst wie ein Alchimist in menschlichen Emotionen.
Mein Argwohn wuchs. Selten schrieb ich längere Passagen in einem Stück, ich überlegte und formulierte zwischendurch im Kopf. Diese Pause war keine gewöhnliche, mir fehlten einfach die Worte, um mit der Wut von Stefan umzugehen! Ich selbst war nie ausfallend geworden und lenkte die Wucht der Verlagsabsagen stets nach innen und gab mich nach außen deprimiert.



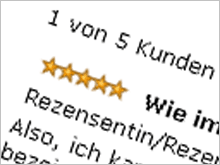
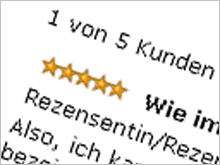 Neuerdings wandert wieder eine Welle der Verwunderung durchs Internet, die offensichtlich durch einen
Neuerdings wandert wieder eine Welle der Verwunderung durchs Internet, die offensichtlich durch einen 
 Das kommt dabei heraus, wenn man sich ausschließlich im Internet informiert und einfach abschreibt, was
Das kommt dabei heraus, wenn man sich ausschließlich im Internet informiert und einfach abschreibt, was 
 Die Anfrage kam über unser MySpace-Profil, das wir vor einigen Wochen
Die Anfrage kam über unser MySpace-Profil, das wir vor einigen Wochen 
 Der von vielen als »Kultautor« verehrte und geschätzte Autor
Der von vielen als »Kultautor« verehrte und geschätzte Autor