 Das ging ja fix. Im letzten Oktober gestartet, wird die Literatur-Sendung »Wickerts Bücher« nach der nächsten Ausgabe im Mai schon wieder eingestellt. Ulrich Wickert selbst habe die ARD darum gebeten. Die Vorbereitung auf die Sendung habe zu viel Zeit in Anspruch genommen, so der Moderator in einem Interview mit der FAZ. Wickert will diese Zeit besser für das Schreiben eigener Bücher nutzen. Ganz nachvollziehbar ist diese Ausrede nicht, denn »Wickerts Bücher« wird als Radiosendung überleben. Dann jedoch nur mit einem Studiogast.
Das ging ja fix. Im letzten Oktober gestartet, wird die Literatur-Sendung »Wickerts Bücher« nach der nächsten Ausgabe im Mai schon wieder eingestellt. Ulrich Wickert selbst habe die ARD darum gebeten. Die Vorbereitung auf die Sendung habe zu viel Zeit in Anspruch genommen, so der Moderator in einem Interview mit der FAZ. Wickert will diese Zeit besser für das Schreiben eigener Bücher nutzen. Ganz nachvollziehbar ist diese Ausrede nicht, denn »Wickerts Bücher« wird als Radiosendung überleben. Dann jedoch nur mit einem Studiogast.
Wir erinnern uns an die furiose Auftaktsendung, die wirkte, als käme sie direkt von der Sonnenterrasse eines Seniorenstifts. Immerhin garantierte Wickert selbst den von hartnäckigen Einschlafstörungen Geplagten ein Wegdösen binnen Sekunden. Sie werden Wickert vermissen – oder künftig Radio hören müssen. Eine überflüssige und schnarchlangweilige Literatursendung für Oberstudienräte wird beendet.
Schade nur, dass es damit generell eine Literatursendung im Fernsehen weniger gibt. Denn einen Ersatz wird es nicht geben, da die Kulturchefs der ARD ohnehin im Mai entscheiden wollten, ob »Druckfrisch« mit Denis Scheck oder »Wickerts Bücher« aufgrund der geringen Zuschauerzahlen abgesetzt wird. Wickerts Entscheidung hat die der ARD obsolet gemacht. Zum Glück! Denn ginge es nach Zuschauerzahlen, so stünden im Schnitt 420.000 (Scheck) gegen 520.000 (Wickert). Schecks Art der Literaturkritik ist umstritten, doch kommt seine Sendung im Vergleich zu Wickert wie ein bunter Kindergeburtstag daher. Scheck regt (gelegentlich) mit seinen harten und deutlichen Urteilen auf – und seine Sendung macht Spaß. Wir sollten Wickert danken!





 In ihrer Sonntagsausgabe vom 29.04.2007 berichtet die Neue Zürcher Zeitung über Literatur und literarische Weblogs im Internet. Der Artikel ist erfreulicherweise auch online nachzulesen. Die Autorin Regula Freuler stellt darin fest, dass man im deutschsprachigen Raum die wirklich interessanten »Litblogs« an einer Hand abzählen könne. Die meisten seien nichts anderes als verkappte Werbeträger, die keinerlei Interesse an verkaufsbeeinträchtigenden Verrissen hätten. Außerdem kämen viele Blogs nach einer enthusiastischen Anfangsphase nicht über die »Bloghalbwertszeit« hinaus, die bei einem Jahr liege.
In ihrer Sonntagsausgabe vom 29.04.2007 berichtet die Neue Zürcher Zeitung über Literatur und literarische Weblogs im Internet. Der Artikel ist erfreulicherweise auch online nachzulesen. Die Autorin Regula Freuler stellt darin fest, dass man im deutschsprachigen Raum die wirklich interessanten »Litblogs« an einer Hand abzählen könne. Die meisten seien nichts anderes als verkappte Werbeträger, die keinerlei Interesse an verkaufsbeeinträchtigenden Verrissen hätten. Außerdem kämen viele Blogs nach einer enthusiastischen Anfangsphase nicht über die »Bloghalbwertszeit« hinaus, die bei einem Jahr liege.
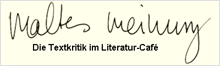
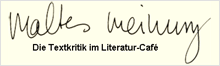 Malte Bremer bespricht in unserer Rubrik »Textkritik« diesmal einen Prosatext. Der Inhalt ist grausam und der Text altertümlich. Die Kombination könnte durchaus passend sein, wenn da nicht ein paar inhaltliche Merkwürdigkeiten stören würden.
Malte Bremer bespricht in unserer Rubrik »Textkritik« diesmal einen Prosatext. Der Inhalt ist grausam und der Text altertümlich. Die Kombination könnte durchaus passend sein, wenn da nicht ein paar inhaltliche Merkwürdigkeiten stören würden.

 Ein Beitrag auf ARD.de, in dem es um anscheinend boomende Literaturportale im Internet geht, führte uns über die verwandten Beiträge auf ein sehr interessantes, drei Monate altes Interview mit Andreas Paschedag, der seit sechs Jahren Lektor beim Aufbau-Verlag ist. Seine Tipps, wie man bei einem großen Verlag unterkommt oder zumindest welche Fehler man vermeiden sollte, lesen sich wie eine Zusammenfassung all dessen, was immer wieder im literaturcafe.de zu finden ist. Wir erlauben uns daher eine Zusammenfassung der Zusammenfassung der häufigsten Fehler.
Ein Beitrag auf ARD.de, in dem es um anscheinend boomende Literaturportale im Internet geht, führte uns über die verwandten Beiträge auf ein sehr interessantes, drei Monate altes Interview mit Andreas Paschedag, der seit sechs Jahren Lektor beim Aufbau-Verlag ist. Seine Tipps, wie man bei einem großen Verlag unterkommt oder zumindest welche Fehler man vermeiden sollte, lesen sich wie eine Zusammenfassung all dessen, was immer wieder im literaturcafe.de zu finden ist. Wir erlauben uns daher eine Zusammenfassung der Zusammenfassung der häufigsten Fehler.
 »Lesen jetzt in Web 2.0?« heißt der Vortrag, den der Inhaber des literaturcafe.de, Wolfgang Tischer, am 3. Mai 2007 um 20 Uhr (MESZ) in der digitalen Welt Second Life halten wird. Welche Möglichkeiten bieten Weblogs, Podcasts, MySpace, YouTube und Second Life für das Marketing im Buch- und Literaturbereich? Erreicht man damit
»Lesen jetzt in Web 2.0?« heißt der Vortrag, den der Inhaber des literaturcafe.de, Wolfgang Tischer, am 3. Mai 2007 um 20 Uhr (MESZ) in der digitalen Welt Second Life halten wird. Welche Möglichkeiten bieten Weblogs, Podcasts, MySpace, YouTube und Second Life für das Marketing im Buch- und Literaturbereich? Erreicht man damit