Ich erwachte aus meiner Reglosigkeit und steckte den Brief zurück in den Briefumschlag. Zu viel Intellektuelles würde dem Ruf des Verlages schaden, dachte ich, als ich die Treppenstufen langsam nach oben stapfte. Neulich, in der Szene, hatte Pia festgestellt, ich könne sehr sarkastisch sein und angedeutet, ich solle vielleicht das Genre wechseln. Sie forschte in meinem Gesicht und ich fühlte Interesse von ihrer Seite wie lange nicht mehr. Wahrscheinlich sei ich aber einfach nur neidisch, war nach einigen Sekunden die nüchterne Quintessenz. Ich bekämpfte meine Enttäuschung mit dem Bier, das sie vor mir auf den Tresen stellte.
»Verdammter Mist!« Ärgerlich betrachtete ich den Briefkastenschlüssel, mit dem ich versuchte hatte, die Wohnungstür zu öffnen. Ich warf den Briefumschlag auf die Fußmatte und hockte mich auf die Treppe.
Kallweit, natürlich! Im Haus wohnte ein Klempner, der nichts zu tun hatte. Schlosser oder Klempner, was machte das schon aus? Zwei praktische Hände waren gefragt. Ich ging hinunter und läutete. Kallweit öffnete selbst. Er trug seine Einheitskluft, blaue Hose, graues Unterhemd, die Ränder unter den Achseln von Schweiß verfärbt, und – so ziemlich das Letzte, was ich ihm zugetraut hätte – Filzpantoffeln.
»Na?« Kallweit war einen Kopf größer als ich, kräftig gebaut, ungefähr fünfzig, mit kurz geschnittenen dunkelblonden Haaren und Bartstoppeln, zu denen ich nicht sagen konnte, ob er schlecht oder gar nicht rasiert war.
»Ich wollte zu Ihnen, ja«, sagte ich. »Meine Wohnungstür ist zu. Präziser gesagt: Ich komme nicht mehr hinein. Der Schlüssel ist drinnen und ich bin draußen.«
»Du bis der Schnösel aussem dritten, nich?«
Von Kallweit musste ich mich nicht beleidigen lassen. »Hören Sie … «
»Der dat Kabel vom Klo runterlässt«, unterbrach er mich.
Ich schluckte. Ein Schriftsteller benötigt Anregungen, er kann sich nicht nur auf Eingebungen verlassen; der Grund, warum ich wohl das längste Mikrofonkabel in der Stadt besaß. Aus dem Badezimmerfenster hatte ich das Mikro langsam in den Hof heruntergelassen, ihre Gespräche aufgenommen und auch schon mal halbe Vormittage auf der unteren Treppenstufe verbracht, das Mikrofon im Ärmel der Jacke und den Eingangsregler voll aufgedreht.
»Ich lass mich nich verscheissan«, sagte Kallweit und gab mir mit zwei deftigen Ohrfeigen rechts und links keine Chance, nach einer Entschuldigung zu suchen. Die ganze Zeit hatte er Bescheid gewusst und sich nichts anmerken lassen! Ich setzte mich auf den Hausflur, rappelte mich wieder hoch, um mich trotz der Schuldgefühle in eine gleichwertige Position zu bringen. Meine Ohren dröhnten und beide Gesichtshälften brannten.
»Eins eins.« Kallweit hörte sich nicht verärgert, sondern wohlwollend an. Ich entschied, die Ohrfeigen als berechtigt abzuschreiben und traute mich, das Gesicht in beiden Händen, die Frage nach einem Dietrich zu stellen. Statt einer Antwort sah mich Kallweit einfach nur an, und das machte mich noch unsicherer.
»Es ist nicht so, wie Sie denken – mehr studienhalber, es war nicht persönlich gemeint«, stammelte ich in dem Glauben, eine Erklärung abgeben zu müssen.
»Wenichstens hasse keine große Klappe.« Kallweit drehte den Kopf in die Diele. »Olga!« rief er, »wie lang noch?«
»Zehn Minuten«, tönte es aus der Küche.
»Ich möchte nicht stören«, sagte ich, »und verantwortlich sein, wenn der Haussegen schief hängt.«
»Red nich so g’schert!« Aus Kallweits Mund klang die Verbindung von Ruhrpott und dem hiesigen Dialekt spaßig. »Ich hol dat Wärkzeug. Geh schomma rauf«, forderte er mich auf und schloss die Tür vor meiner Nase.
Kaum war ich oben angekommen, hörte ich schon Kallweits Schritte auf der Treppe. Alle Achtung, er war zuverlässig. Kallweit steckte den Dietrich in das Schloss, fummelte ein wenig – und klack, die Tür öffnete sich.
»Da habe ich noch mal Schwein gehabt«, seufzte ich erleichtert.
»Willze dir nichma ein Sichaheitsschloss anbring?«
»Bei mir gibt es nichts zu klauen«, antwortete ich.
Kallweit bückte sich und nahm den Briefumschlag von der Matte. »Deine Post.«
Die penetrante Duzerei gefiel mir nicht. Ich dachte an das lange Mikrofonkabel und wagte keinen Protest, sprach dem Du sogar eine gewisse Berechtigung zu. Schließlich war ich in Kallweits Privatsphäre eingedrungen und konnte nicht erwarten, ehrerbietig mit Sir angeredet zu werden. Eher schon mit Ohrfeigen begrüßt.
»Danke. Darf ich Sie zu einem Gläschen einladen?«
»Schnaps? Da sachich nich nein.«
Ich holte den Aquavit und zwei Schnapsgläser aus dem Eisfach.
»Dir fehlt ne Frau wie Olga«, sagte Kallweit. Überrascht drehte ich mich um. Wie selbstverständlich war er mir in die unaufgeräumte Küche gefolgt. »Die jungen Weiba heut, die hamm nur Flausen im Kopp. Sind alle hintam Geld her. Hass wohl keine Kohle, was?«
»Ich bin arbeitsloser Schriftsteller.« Ich drückte Kallweit die frostbeschlagenen Gläser in die Hand und goss vorsichtig ein. Wir prosteten uns zu.
»Dat is wat Reelles«, sagte er anerkennend.
»Möchten Sie noch einen?«
»Den habich gut,« winkte Kallweit ab. Er deutete mit dem Daumen nach unten. »Dat geht ihr nämmich anne Närven. Ärst kochtse, dann is keiner da. Wie bei Muttern. Da gabs wat hinter die Löffel.«
Der Mann war rücksichtsvoller, als mir die Tonbandaufnahmen offenbarten. Zumeist kommandierte er seine Familie, nur sein Sohn gab ihm Kontra. Olga pflegte ihn mit einem auf der zweiten Silbe langgezogenen, nur einen Ton ausmachenden Kalleinz zu rufen. Karl-Heinz musste Anfang zwanzig sein und eine eigene Bude haben, denn er kam und ging unregelmäßig. Ich schätzte seine Sprüche; du gehs mir auffen Senkel, Alter, war zwar nicht originell, aber sorgte für Stimmung zwischen Vater und Sohn.
Kallweit verabschiedete sich. »Wennze Zeit hass, kannze anschelln. Ich hab imma Zeit.«
Auch das noch. »Mach ich!« rief ich ihm in gekünstelter Heiterkeit nach. »Und nochmals danke.«
Ich stopfte den Aquavit ins Eisfach neben die Packung Rahmspinat. Das Eis war schon wieder dickbauchig und drohte, über die Kanten zu wachsen und die Eisfachtür zu sprengen. Die Dichtung war hinüber. Ich stocherte und hackte große und kleine Eissplitter aus dem Eisfach und nutzte die Gelegenheit, gleich mit der Hausarbeit fortzufahren. Bei schlechten Nachrichten wurde ich reinlich. Bisher kamen die Absagen zwar in etwa gleichmäßigen Abständen, aber nicht häufig genug, um mir zu einer durchgehend sauberen Wohnung zu verhelfen. Putzen gegen den Frust, davon hatte ich neulich in einer Zeitung gelesen. Pia, die zwei Semester Psychologie studiert hatte, bevor sie die Fakultät wechselte, diagnostizierte, ich wolle mich vom Makel des Misserfolges reinwaschen. Ich hielt nichts von dieser tiefenpsychologischen Interpretation. Lieber hätte ich Holz gehackt, da könnte ich einfach drauflos schlagen wie im Stall der Almhütte. Dort erhielt ich aber keine Post, dort war das Holzhacken Arbeit und keine Therapie, denn ohne Brennholz ist es auf sechzehnhundert Metern auch im Sommer verdammt kalt.
Nach drei Stunden mit Staub, Fettresten und festgetretenen Krümeln lehnte ich mutlos an der Küchentür. Keine Schlieren mehr, streifenfrei, trotzdem keine Aussicht, bis auf den Blick auf die alte Anrichte mit dem Aufsatz und den verglasten Türen, hinter denen mein Geschirr stand.




 Der
Der 

 Nicht für Geld in Buchform, sondern kostenlos auf ihrer Website veröffentlicht Elfriede Jelinek ihren neuen Roman. »Neid« heißt das jüngste Werk der Literaturnobelpreisträgerin von 2004. Das erstes Kapitel ist unter
Nicht für Geld in Buchform, sondern kostenlos auf ihrer Website veröffentlicht Elfriede Jelinek ihren neuen Roman. »Neid« heißt das jüngste Werk der Literaturnobelpreisträgerin von 2004. Das erstes Kapitel ist unter 
 In den USA verkauft die Café-Kette
In den USA verkauft die Café-Kette 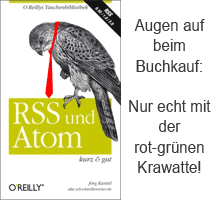


 Der Herausgeber des literaturcafe.de, Wolfgang Tischer, wird am kommenden Samstag, 7. April 2007, Gast in der Sendung »Blogspiel« des
Der Herausgeber des literaturcafe.de, Wolfgang Tischer, wird am kommenden Samstag, 7. April 2007, Gast in der Sendung »Blogspiel« des