»Es ist keine Zeit zu streiten«, sagte er eindringlich. »Wir müssen zusehen, dass wir in die Hütte kommen, sonst holen wir uns den Tod. Eine ordentliche Erkältung, meine ich.«
»Sie bringen mich in keine Hütte, sondern nach Hause. Sofort. Sonst wird es Ihnen leid tun.«
»Bei dem Wetter? Wenn ich mit dem Wagen auf dem Schnee ins Rutschen komme, haben wir gute Chancen, eine Abkürzung zu nehmen. Immerhin wirkungsvoller, als hier langsam zu erfrieren.«
»Dann gehe ich allein zu Fuß.«
»Möchten Sie wissen, wie weit wir im Gebirge sind? Bis zum Dorf sind es zwölf Kilometer Luftlinie und achtzehn Kilometer zu gehen.«
»Wo sind wir?«
»Das erkläre ich Ihnen später. Jetzt müssen wir unbedingt ins Trockene. In der Hütte gibt es einen Ofen.«
»Wo ist diese verdammte Hütte?«
»Ein Stück über der Felswand, vor der wir stehen. Sie heißt Weiße Wand, weil der Kalkfelsen so deutlich zum Vorschein kommt.«
Bettina trat einen Schritt ins Freie und warf einen kurzen Blick nach oben. »Haben Sie Seil und Pickel dabei? «
»Schön, dass Sie Ihren Humor wiedergefunden haben.«
»Wir werden sehen, wer am Ende noch lacht!«
»Sparen Sie sich Ihre Energie. Ich werde Sie mit dem Lastenlift nach oben bringen.«
»Ich lasse mich von Ihnen doch nicht wie ein Gepäckstück behandeln!«
»Ich zeige Ihnen den Lift«, unterbrach er sie beim Luftholen.
Er ging voraus zu einem Holzverschlag, aus dem Seile über einen Stahlträger in die Höhe führten. Am Seil hing ein Tragkasten aus Holz mit einem umlaufenden, verbogenen Eisengitter. Ein zweiter Mast ragte wie ein stählerner Finger vom Grat der Weißen Wand schräg in den Himmel und trotzte den Gesetzen der Schwerkraft. Nah über seiner Spitze trieben die Schneewolken.
»Niemals!« sagte Bettina.
»Es gibt keine Wahl. Bei Regen, Schneefall und Kälte kraxelt niemand durchs Gebirge, höchstens die Bergwacht, um unvorsichtige Touristinnen zu retten. Nur in einer Hütte ist man sicher aufgehoben. Also erst Sie, dann das Gepäck und die Vorräte. Sie laden oben aus und dann komme ich über den Fußsteig nach.«
»Ich ziehe das Risiko mit dem Auto vor«, sagte sie entschlossen.
Stefan überlegte. »Also gut«, lenkte er ein, »ich bringe das Gepäck mit dem Lift nach oben. Anschließend gehen wir beide zu Fuß.« Er musterte ihre Schuhe. »Der Aufstieg ist bei Nässe nicht ungefährlich. Der Pfad ist schmal und steil und Sie haben Straßenschuhe an, Sie bekommen kalte Füße und das macht Sie steif und ungelenkig. Sie täten wirklich gut daran, auf mich zu hören.«
Bettina ließ ihn stehen und ging zum Wagen zurück.
Eine gewaltfreie Entführung ist eine verdammt anstrengende Sache, dachte Stefan. Man benötigt triftige Argumente, um das Entführungsopfer zum Mitgehen zu veranlassen. Bettina war störrisch wie ein Esel. Allerdings konnte er nicht erwarten, dass sie ihm willig folgen würde.Während er die Vorräte und das Gepäck vom Wagen zum Lift schleppte, stand sie nur da und vertrat sich die Füße auf der Stelle, wie eine Madonna mit Umhang. Als er sie aufforderte, sich in den Wagen zu setzen, gehorchte sie zu seiner Überraschung.




 Heute, am 7. Juni 2007, wäre die Lyrikerin Mascha Kaléko 100 Jahre alt geworden. Grund genug, um noch einmal auf den
Heute, am 7. Juni 2007, wäre die Lyrikerin Mascha Kaléko 100 Jahre alt geworden. Grund genug, um noch einmal auf den 
 Diesmal: Literaturforen im Internet
Diesmal: Literaturforen im Internet
 Nachdem unsere
Nachdem unsere 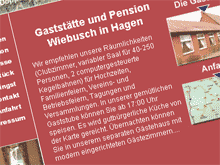
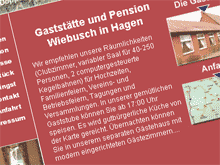 Frank Schulz liest am 28. Juni 2007 in Hagen aus seiner Hagener-Trilogie. Ort der Lesung ist einer der Origialschauplätze der Romane, und zwar die Gaststätte »
Frank Schulz liest am 28. Juni 2007 in Hagen aus seiner Hagener-Trilogie. Ort der Lesung ist einer der Origialschauplätze der Romane, und zwar die Gaststätte »