»Da ist er wieder,« sagte der Mann mit der roten Jacke über dem weißen Hemd. Ein anderer Mann in Rot beugte sich über ihn und winkte mit den Fingerspitzen. »Willkommen.«
Der Wagen nahm eine scharfe Rechtskurve, ohne die Geschwindigkeit wesentlich herabzusetzen.
»Schorsch, lass gut sein«, rief der erste Mann in Rot nach vorn. »Sonst fällt er uns von der Trage und verletzt sich ernsthaft.«
Stefan tastete nach der schmerzenden Stelle am Kopf und fühlte einen Verband.
»Nur eine kleine Platzwunde. Habe ich auch mal gehabt, als ich als Kind von der Schaukel gefallen bin.« Der Notarzt pumpte die Manschette um Stefans Oberarm auf. Langsam entwich die Luft. »110 zu 70. Es geht aufwärts. Hatten Sie schon mal früher Probleme mit dem Kreislauf?«
Stefan verneinte. »Wohin fahren wir?«
»Zu den Barmherzigen Schwestern.«
»Ich möchte nicht ins Krankenhaus. Ich fühle mich schon wieder in Ordnung.«
»Haben Sie heute noch was vor?«
»Wieso?«
»Wenn ein kräftiger Kerl wie Sie bei 28 Grad auf der Straße mfällt und zehn Minuten im Koma liegt, ist das kein Spaß mehr. Oder hast du an der Stelle eine Laterne gesehen, Karl?«
Karl lachte. »Auch kein Verkehrsschild, Doc.«
»Es war ein Überfall«, stöhnte Stefan.
»Sicher.« Der Arzt langte auf eine Ablage und warf Stefan das Portemonnaie in den Schoß. »Die Johanniter fahren ihre Opfer anschließend ins Krankenhaus. Das gebietet uns die Nächstenliebe.«
Stefan verdrehte die Augen.
»Na, na«, sagte der Arzt, »für uns sind Sie die reinste Erholung. Kein Vergleich mit den lebenden Fleischklumpen, die man uns häufig in den Wagen legt. Das soll nicht heißen, dass Sie keine ärztliche Hilfe benötigen. Wir nehmen jeden Fall ernst.«
Der Wagen stoppte vor der Unfallaufnahme, die Tür wurde aufgerissen und die Trage herausgezogen. In der Ambulanz richtete sich Stefan auf.
»Der Mann wurde auf der Straße gefunden. Ohnmächtig«, instruierte eine Schwester den Arzt.
Der Arzt öffnete den Kopfverband. »Lassen Sie mal sehen.«
»Machen Sie sich mit mir keine Umstände«, bat Stefan.
»Glück gehabt«, sagte der Arzt. Er schnippelte mit einer Schere Haare von Stefans Hinterkopf. »Nur eine oberflächliche Wunde nah am Haaransatz. Mull und Pflaster reicht. Wir brauchen nicht zu nähen. – Elke«
Die Schwester reichte dem Arzt ein Stück Mull.
»Warum habe ich dann den Kopfverband bekommen?« erkundigte sich Stefan.
Der Arzt schnitt vom Mull die Hälfte ab und reichte der Schwester das Stück zurück. »Auf dem Wagen, die können gar nicht mehr anders. Pflaster.«
»Erholung nannte mich der Notarzt.« Stefan hüpfte von der Trage. »Vielen Dank. Dann kann ich jetzt gehen?«
»Wir sollten vorsichtshalber röntgen.«
»Mir ist aber nicht übel«, wandte Stefan ein.
»Aber mir. Weil die Patienten nicht auf meinen ärztlichen Rat hören.«
»Kommen Sie!« Schwester Elke brachte Stefan zur Tür und zeigte ihm den Weg zur Aufnahme. Hier wurde er als Stefan Bruhks aktenkundig gemacht, zwei Flure weiter zum Röntgen geschickt und danach in der Ambulanz auf dem Gang in die Reihe der Wartenden gesetzt, neben eine Frau mit einem Gips links bis unter das Knie. Stefan betrachtete eine Zeitlang ihre Zehen, danach den Saum des sorgfältig auf Bermuda-Short-Länge gekürzten Hosenbeins.
»Heute kommt er runter.« Die junge Frau klopfte mit einer Krücke auf den weißen Gips. Keine handschriftlichen Genesungswünsche, keine pfeildurchbohrten Herzen. Seltsam, dachte Stefan, mit der Frau kann man sich doch sehen lassen.
Wir wollen doch niemanden diskrimminirrn! tönte Bichlers Stimme. Stefan erschrak. Nein, beruhigte er sich, das war kein zweiter Alfred, sondern eine ganz normale Erinnerung. Jeder hatte Familie, Freunde, Bekannte, und es machte keinen Unterschied, ob man hübsch war oder nur leidlich aussah.
»Ich bin beim Aufwärmen einfach umgefallen«, erzählte die Frau unaufgefordert. »Das hat vielleicht geknallt! Der Übungsleiter wollte mich nach Hause bringen, aber ich habe ihm gesagt, dass ich das alleine schaffe. Es sind ja nur zwei Kilometer von der Halle bis zu unserem Haus und ich hatte mein Auto dabei. Abends hat mein Mann den geschwollenen Fuß abgetastet und gefragt, wo denn meine Achillessehne sei. Am nächsten Morgen bin ich zum Orthopäden gegangen, mittags lag ich im Krankenhaus.«
»Einfach so?«
»Der Arzt war fassungslos, dass man mich nicht sofort ins Krankenhaus gebracht hat. Ich war neu in der Gruppe.« Die Frau lachte warmherzig. »Nach vierzehn Tagen wurde ich entlassen, mit Mühe und Not. Ich musste die Stationsärztin bequasseln. Vier Wochen lang konnte ich nicht duschen, weil mir der Gips bis zu den Pobacken reichte.«
Gegenüber öffnete sich eine Tür. »Frau Bleck?« rief eine Schwester.
»In diesem Moment beginnt ein neues Leben.« Die junge Frau sprach schon in Richtung auf den Behandlungsraum und humpelte los.
 Mal wieder routinemäßig auf literaturportal.de geschaut, jenes Internet-Angebot des Literaturarchivs Marbach, das laut Aussage des Kulturstaatsministers 150.000 Euro an öffentlichen Fördergeldern erhalten hat, im Juni 2006 online ging, bereits seit Oktober 2006 redaktionell nicht mehr gepflegt wird und zur Ruine verkommen ist.
Mal wieder routinemäßig auf literaturportal.de geschaut, jenes Internet-Angebot des Literaturarchivs Marbach, das laut Aussage des Kulturstaatsministers 150.000 Euro an öffentlichen Fördergeldern erhalten hat, im Juni 2006 online ging, bereits seit Oktober 2006 redaktionell nicht mehr gepflegt wird und zur Ruine verkommen ist.




 Deutschland beichtet: Wir haben gedopt! Im Radsport hat es angefangen. Mit bebender Stimme und ergreifenden Worten gestehen Sportler: Ich habe unerlaubte Dopingmittel genommen, und ich schäme mich dafür! Es gibt nur wenige ehrliche und aufrichtige Geister wie
Deutschland beichtet: Wir haben gedopt! Im Radsport hat es angefangen. Mit bebender Stimme und ergreifenden Worten gestehen Sportler: Ich habe unerlaubte Dopingmittel genommen, und ich schäme mich dafür! Es gibt nur wenige ehrliche und aufrichtige Geister wie 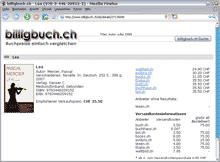
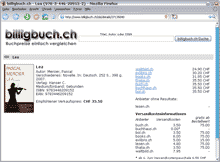 In Lotree’s Bücherblog findet sich
In Lotree’s Bücherblog findet sich 
 Wie jedes Jahr am 25. Mai ist heute
Wie jedes Jahr am 25. Mai ist heute 
 oder: Black Hole Sun / Wurst will come
oder: Black Hole Sun / Wurst will come
 Barbara Rampf (Foto) hat im Rahmen ihrer Magisterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München allerlei Fragen an Podcasthörer und -seher. Wieder einmal geht es darum herauszufinden, wer Podcasts nutzt. Da es sich um eine seriöse und rein wissenschaftliche Arbeit ohne kommerziellen Hintergrund handelt, wird man weder nach Namen noch nach Kontaktdaten gefragt. Zudem sind die Fragen – im Gegensatz zu manch anderer Umfrage – klar und deutlich formuliert.
Barbara Rampf (Foto) hat im Rahmen ihrer Magisterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München allerlei Fragen an Podcasthörer und -seher. Wieder einmal geht es darum herauszufinden, wer Podcasts nutzt. Da es sich um eine seriöse und rein wissenschaftliche Arbeit ohne kommerziellen Hintergrund handelt, wird man weder nach Namen noch nach Kontaktdaten gefragt. Zudem sind die Fragen – im Gegensatz zu manch anderer Umfrage – klar und deutlich formuliert.
 Mein Name ist Cornelia Travnicek, ich bin 20 und schreibe. Per Definition bin ich daher wohl das, was man als Jungautorin bezeichnet. Und das hier, das ist ein Praxisbericht aus mittlerweile sieben Jahren Literaturbetrieb. Wie man es machen könnte, vielleicht sollte, vielleicht eher nicht und was einem alles passieren kann. Auch
Mein Name ist Cornelia Travnicek, ich bin 20 und schreibe. Per Definition bin ich daher wohl das, was man als Jungautorin bezeichnet. Und das hier, das ist ein Praxisbericht aus mittlerweile sieben Jahren Literaturbetrieb. Wie man es machen könnte, vielleicht sollte, vielleicht eher nicht und was einem alles passieren kann. Auch