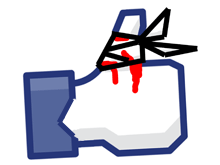Montagmorgen, 8 Uhr früh. Hatte zufällig noch einen freien Parkplatz erwischt, vor dem Spital, rannte auf den Eingang zu, wo mich die automatische Schiebetür zu einem kurzen Halt zwang. Beim Empfangschalter wurde ich zum zweiten Mal gezwungen, anzuhalten, ich stammelte: »Joseph? Joseph McPhee? Mein Sohn. Er wurde gestern Abend eingeliefert.« »1. Stock, Zimmer 101.« Die Dame schien meine Verunsicherung zu bemerken, nickte mir kurz aufmunternd zu, dann wandte sie sich wieder ihrer Arbeit zu. Ich hatte fast kein Auge zugetan letzte Nacht. Sie hatte sich dahin gezogen. Und hatte mich durch alle Ebenen stürzen lassen. Schweißgebadet wälzte ich mich in meinem Bett hin und her. Schreckliche Gedanken quälten mich, klammerten sich fest. Es waren Fragen über Fragen. Ich machte mir schreckliche Vorwürfe. Ich machte Wilfred, meinem Mann schreckliche Vorwürfe. Was wäre gewesen, wenn … Hätte ich doch .. Hätten wir doch … Am Ende blieb mir nur noch eine Frage, was sage ich morgen zu Joe, wenn ich zu ihm gehe? Was sagt man überhaupt zu seinem Kind in solch einer Situation? Ich rang verzweifelt nach Worten, lebensbejahenden Worten, – drehte und wendete sie. Bis ich sie fand. Die richtigen Worte. Ich wurde ruhiger und schlief wenigstens ein bisschen. Mein Sohn musste wegen einer Überdosis an Tabletten ins Spital eingeliefert werden. Ich dachte immer, so was komme in Filmen, im Fernseher, in Büchern vor, aber nicht in Wirklichkeit, nicht in meiner Wirklichkeit, bis jetzt, bis gestern Abend, bis es passierte. Auch jetzt konnte ich es noch nicht fassen. Es fühlte sich so unwirklich an, wie ich auf das Zimmer 101 zulief, kurz anklopfte, dann eintrat – die Tür hatte offen gestanden -. Da fand ich Joey wieder, in dem einzigen Bett in diesem Zimmer, eingebettet in weißem weichen Bettzeug. Sein Gesicht mit dem hellen Haarwuschel erschien mir bleich, seine Nase breiter, seine Gesichtszüge markanter, ein anderes Mal waren sie weicher. Von seinen Lippen kam ein schwaches, aber deutliches »Hallo Mam«. »Wie geht es Dir?« Ich fasste nach seiner Hand. Das tat gut, seine Hand in meiner. Eine robuste Pflegefachfrau trat hinzu mit frischem Tee, freundlich lächelnd sagte sie, »Guten Morgen, Frau McPhee? Josephs Mutter? Hab ich Recht?« Mit einem Anflug von Trotz bejahte ich, »das bin ich, Joes Mutter.« Wilfred, mein Mann, hätte das gar nicht gerne gehört, diesen Namen, meinen früheren Namen. Aber er war nicht da und er würde auch nicht kommen. Ich fühlte mich sicher. Sie fuhr fort: »Joseph hat alle paar Stunden Kohletabletten mit Flüssigkeit verabreicht bekommen, zur Beruhigung seines Magens. Die Nacht war wohl etwas kurz, aber sonst, denke ich, geht es meinem Patienten heute Morgen schon wieder viel besser, nicht wahr, Joseph?« und hakte mit einem fröhlichen Zwinkern nach, »Ruh dich erstmal aus.« »Und, Frau McPhee, Doktor Brunschweiler wird bald eintreffen, falls Sie auf ihn warten möchten.« »Ja, ich bleibe noch ein bisschen.« Dann verabschiedete sie sich: »Ich gehe jetzt nach Hause. Wie ich mich auf mein Bett freue! Alles Gute. Mach’s gut, Joseph.« Beneidenswert, die sprudelnde Fröhlichkeit dieser Frau trotz eines langen harten Dienstes! Ob sie wohl auch Kinder hat? Sie wäre eine gute Mutter. Da war ich mir sicher. Geduldig, bestimmt, fröhlich. Nicht so wie ich. Ich hatte plötzlich das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben. Als Mutter versagt zu haben. Ich konnte nun endlich sagen, was worüber ich mir letzte Nacht den Kopf zerbrochen hatte, »Bitte, mach das nie wieder! Versprich es mir, ja?«»Ja.« Es war ein leises, aber deutlich hörbares Ja. Das wollte ich hören. In diesem einen Moment. Mehr nicht. Es war, wie wenn wir an einer Weggabelung angekommen waren, müde und erschöpft. Wir wussten beide nicht mehr weiter. Hatten hart gekämpft, jeder auf seine Art (und Weise). Nun gönnten wir uns eine Verschnaufpause. Im Spital. In diesem einen Zimmer, mit Blick auf das Dächermeer der Stadt, der riesigen Apparatur in der einen Ecke, vom Gang her das unverkennbare dumpfe Aufeinanderklatschen von sich nähernden und wieder entfernenden in Pantoffeln steckenden Füßen, dem fernen Klingeln eines Telefons, dem gedämpften Stimmengewirr, hie und da verhaltenes Gekicher. Da fühlten wir uns geborgen, ungestört, ganz einfach legitimiert zusammen zu sein. Zuhause war das schwierig geworden, zeitweilig fast unmöglich. Es klopfte. Dr. Brunschweiler, Joes behandelnder Arzt stand neben uns, begrüßte uns mit einem festen Händedruck. Wir kannten uns, hatten gestern Abend miteinander telefoniert. Er kam gleich zum Kern der Sache, Joseph werde vorübergehend in die Psychiatrie verlegt. Zur Überwachung und weiteren Abklärungen. Joes Lächeln verschwand. Er fuhr unbeirrt fort, versuchter Suizid, das erfordere, er wiederholte, eine Einweisung in die Psychiatrie. Die übliche Handhabung. Zum Wohle des Patienten. Das saß. Das Schreckgespenst hatte einen Namen bekommen. Suizidversuch!
Textkritik: Schönenbergers – Romananfang
Zusammenfassende Bewertung
Standardanfang und Leserbevormundung: So wird das nichts!
Gefühle der Protagonisten des langen und breiten schildern, statt Gefühle im Leser zu erzeugen; einen Text anfangen und sofort unterbrechen, um zu erläutern, was »vorher« gewesen ist, statt das im Laufe des Textes anhand der Entwicklung der Charaktere zu zeigen; einen Text assoziativ verfassen, ohne klaren Plan, sodass sich Widersprüche und Ungereimtheiten ergeben …
Die Kritik im Einzelnen
Da haben wir gleich drei Anfänge auf einmal: den des Romans, den der Woche und den des Tages – das ist ein bisschen viel! Ich würde das streichen – komplett! zurück
Woher will die Protagonistin das wissen? Sie arbeitet nicht im Spital – es könnte ja sein, dass da immer Parkplätze frei sind! Und da es um Eile geht (wie das fehlende Subjekt zu Recht suggeriert), wäre glücklicherweise besser geeignet: Dann hätte die Protagonistin zuvor Angst gehabt, sie müsste nach einem Parkplatz suchen! zurück
Was nun folgt, ist kein stammeln – es sind vollständige Wörter. Das klingt von selbst aufgeregt, ohne dass es betont werden müsste; Also: kein »ich stammelte«, sondern direkter Anschluss der direkten Rede. zurück
Wieso freut sich die Protagonistin nicht einfach über das aufmunternde Nicken, statt sich in überflüssigen Mutmaßungen zu ergehen? Die Dame nickte mir aufmunternd zu – und fertig! zurück
Von hier bis da empfehle ich dringend eine vollständige Streichung! Bislang haben wir den Eindruck von einer aufgeregten Person, die im Spital zu ihrem Sohn will. Warum die Person aufgeregt ist, wissen wir auch: Der Sohn wurde am Abend zuvor eingeliefert. Jeder, der seine 7 Zwetschgen beieinand hat, kann sich denken, wie es diesem Menschen in der Nacht ergangen ist, denn problembeladene Nächte kennt jeder!
Offenbar ist der Ich-Erzähler jedoch ganz anderer Meinung und breitet die ganze Palette ausgelutschtester Klischees aus, was ein Mitfühlen schon im Ansatz verhindert: fast kein Auge zugetan, schweißgebadetes Herumwälzen, schreckliche Gedanken, Fragen über Fragen, man hätte, was soll ich dem anderen sagen, so was komme immer nur in Filmen, im Fernsehen in Büchern vor …
Aufgabe eines Textes ist es, dem Leser Gefühle zu ermöglichen oder Gefühle in ihm zu erzeugen, und nicht, die der Protagonisten auszuwalzen. zurück
Wenn das Vorige gestrichen ist, sollte hier zum besseren Verständnis Joeys Gesicht stehen. zurück
Dieses »ein anderes Mal« gibt Rätsel auf: Wechselt die Wahrnehmung seiner Gesichtszüge? Erscheinen sie der Mutter einmal markanter, dann wieder weicher? Waren sie sonst weicher als jetzt, wo sie markanter sind? Im ersten Fall müsste es im Satz logisch heißen: »erschien[en] […] seine Gesichtszüge mal markanter, mal weicher«, im zweiten Fall wäre weicher zu streichen, da es automatisch in markanter enthalten ist und somit nur noch redundant wäre. Aber »ein anderes Mal« hat hier keinen erkennbaren Sinn. zurück
Wieso Frau McPhee die Frage nach der Mutterschaft mit einem Anflug von Trotz bejaht, kann ich nicht nachvollziehen, denn eine Mutterschaft ist schließlich immer fraglos! Allerdings sollte sie als Mutter sich entscheiden, wie sie ihren Sohn nennt: Taufnahme ist wohl Johannes – aber nennt sie ihn nun Joe oder Joey? Bekommt er zwei Namen wie die Hunde, nämlich einen, wenn er brav ist, und einen anderen, wenn er ermahnt werden muss? zurück
Das wissen wir bereits: Der Mann hätte das nicht gerne gehört, aber er würde auch nicht kommen! Folge? Eben – also streichen! zurück
Warum redet sie nicht einfach weiter? – Es hört sich an, als habe sie den Gedanken der Protagonistin zugehört, bevor die weiterredet … Streichen! zurück
Wenn Medikamente verabreicht werden, geschieht das nach den Anwendungsvorschriften – die müssen aber in einem Text nicht mitgeliefert werden. zurück
Das ist kein Nachhaken – denn sie will ja nicht etwas genauer wissen -, sondern ein Aufforderung oder ein Rat! Ich würde den ganzen Satz streichen und die Pflegekraft sich gleich an die Mutter wenden lassen. zurück
Wieso wird das bisschen hier so betont? Ist ihr Joe oder Joey so unwichtig, dass sie nur noch ein bisschen bleiben will? zurück
Und wieder ein völlig überflüssiger Hinweis: Die Pflegekraft sagt es doch direkt anschließend! zurück
Auch hier: zu viel! Nach der Charakterisierung der Pflegekraft bezüglich derer vermuteten Mütterqualitäten folgt ein völlig ausreichendes, lapidares »Nicht so wie ich« – das muss nicht mehr erläutert werden! Folge? Streichung bis hier! zurück
Da der Text im Präteritum verfasst wurde, ist hier Vorzeitigkeit angesagt, da sie es ja gehört hat: »Das hatte ich hören wollen«. zurück
Diese beiden Sätzlein bringen nicht Erhellendes – warum also nicht einfach streichen? zurück
Auch die Weggabelung (oder Kreuzung) ist ein ziemlich abgegriffenes Bild – aber lassen wir das einmal beiseite; sinnvoller wäre in jedem Falle, dass beide nicht wussten, wohin, und sich deswegen eine Verschnaufpause gönnten – auf das Kämpfen kann dabei getrost verzichtet werden. zurück
Apples iBooks: 10 Tipps und Warnungen fürs Lesen auf dem iPhone
 Ab sofort steht Apples eBook-Lesesoftware »iBooks« für alle iPhones und fast alle iPod-touch-Modelle und natürlich fürs iPad bereit. Parallel dazu öffnet sich in Deutschland Apples eBook-Store für die mobilen Geräte, sodass Bücher gekauft und heruntergeladen werden können. Steve Jobs rühmte sich auf der Entwicklerkonferenz am 7. Juni 2010 in San Francisco damit, dass Apple nun der weltweit größte Buchhändler für elektronische Bücher sei.
Ab sofort steht Apples eBook-Lesesoftware »iBooks« für alle iPhones und fast alle iPod-touch-Modelle und natürlich fürs iPad bereit. Parallel dazu öffnet sich in Deutschland Apples eBook-Store für die mobilen Geräte, sodass Bücher gekauft und heruntergeladen werden können. Steve Jobs rühmte sich auf der Entwicklerkonferenz am 7. Juni 2010 in San Francisco damit, dass Apple nun der weltweit größte Buchhändler für elektronische Bücher sei.
Zum Start in Deutschland ist die Zahl der aktuellen, käuflichen eBooks noch gering, doch immerhin sind beispielsweise die Bestseller-Krimis von Stieg Larsson mit dabei.
literaturcafe.de zeigt Ihnen, wie Sie iBooks auf dem iPhone oder iPod touch installieren und gibt Tipps fürs Lesen auf dem Apple-Handy.
Zuschussverlage sind keine Verlage, meint Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger

Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger hat eine viel beachtete Rede zum Urheberrecht gehalten. Besser als diese nichtssagende Phrase lässt sich der Inhalt ihrer Worte vor der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eigentlich nicht zusammenfassen. »Buzzword-Bingo«-Spieler hätten ihre Freude gehabt.
In der Rede war so ziemlich alles drin, doch nichts gesagt und bloß nichts konkret festgelegt. Die vielfältigen Reaktionen auf die Rede zeigen, dass jeder das heraushören konnte, was ihm urheberrechtlich in den Kram passt.
Und trotz Leutheusser-Schnarrenbergers konkreter Feststellung: »Wir können nicht einfach die Mechanismen der analogen Welt eins zu eins auf die digitale Welt übertragen« wurde zwischen den Zeilen deutlich: »… aber wir werden es dennoch versuchen«.
Mehr verblüffte ein Detail am Rande: So ganz nebenbei definierte die Justizministerin den Begriff »Verlag« und machte deutlich, dass sie Zuschussverlage und Selbstzahlerverlage nicht als Verlage betrachtet.
SchreibStar und Textkritik: Gründen Sie eine Schreibgruppe in Meschuggistan
 Für den Schweizer Verlag Nagel & Kimche (zu Hanser gehörend) hat das literaturcafe.de die redaktionelle Betreuung der Website SchreibStar.tv übernommen. Die Website stellt Milena Mosers Roman »Möchtegern« vor, in dem es um eine fiktive TV-Castingshow für Schriftsteller geht. Im »Trainingscamp« auf der Website kann man sich selbst in Schreibaufgaben aus dem Buch versuchen.
Für den Schweizer Verlag Nagel & Kimche (zu Hanser gehörend) hat das literaturcafe.de die redaktionelle Betreuung der Website SchreibStar.tv übernommen. Die Website stellt Milena Mosers Roman »Möchtegern« vor, in dem es um eine fiktive TV-Castingshow für Schriftsteller geht. Im »Trainingscamp« auf der Website kann man sich selbst in Schreibaufgaben aus dem Buch versuchen.
Heute startet die 7. und letzte Runde, die bis zum 4. Juli 2010 läuft. Die Schreibaufgabe lautet: »Gründen Sie eine Schreibgruppe« – natürlich nur auf dem Papier und nicht länger als 1.500 Zeichen. Die Teilnehmer aller 7. Runden können einen eintägigen Schreibkurs mit Milena Moser in der Schweiz gewinnen – Anreise und Hotel inklusive.
Außerdem bespricht unser Kritiker Malte Bremer exklusiv sechs Romananfänge, die man ihm zusenden konnte. Seit letzte Woche ist Kritik 4 online. Diesmal fiel sie wieder sehr positiv aus. Lernen Sie aus der »Reise nach Meschuggistan«.
Zur Website SchreibStar.tv mit Schreibaufgabe und Textkritik (archive.org) »
Textkritik: Reise nach Meschuggistan – Romananfang
Glas klirrte. Es klirrte in einer Weise, die allen Hörenden aufzeigte, dass soeben ein Mann mit drängenden Fluchtgedanken durch die dünne Fensterscheibe der alten Bibliothek gesprungen war. Ein Pferd wieherte überrascht – vermutlich weil ebenjener Mann auf seinem Rücken gelandet war – und dann hörten die Mönche des Konvents der Wortreichen Brüder nur noch das sich schnell entfernende Geklapper beschlagener Hufe.
Bruder Bibliothekar, Bruder Schreiber und der Novize standen beieinander und beugten sich vorsichtig aus dem Fenster.
»So was«, meinte Bruder Schreiber.
»Ja, sehr ärgerlich«, antwortete Bruder Bibliothekar.
»Müssen sie immer durch das Fenster springen?«, schimpfte Bruder Schreiber. »Das ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass Bruder Glaser es ersetzen muss.« Bruder Bibliothekar nickte betrübt.
»Ein Glück, dass Bruder Glaser sehr dünnes Glas verwendet.«
»Oh ja!«
»Das verstehe ich nicht.« Der Novize runzelte die Stirn. »Würde er stabileres Material verwenden, würde die Scheibe doch gar nicht erst brechen.«
»Ha! Einmal hat er es versucht. Der arme Mann, der sich mit Regulus Regastius’ Miserablen Memoiren absetzen wollte, knallte im vollen Lauf dagegen. Die Scheibe hatte trotz allem einen langen Riss und der Dieb … nun ja, es heißt er könne inzwischen wieder einigermaßen deutlich sprechen. Allerdings stottert er noch immer.« Bruder Schreiber schüttelte den Kopf.
»Was hat er eigentlich gestohlen?«
»Das wertvollste Artefakt in unserem Besitz natürlich«, antwortete Bruder Bibliothekar
»Ach, den Atlas der alten Titanen?«
»Nein, natürlich nicht. Dieses Werk ließe sich kaum von einem einzigen Mann transportieren.«
»Dann das Dynastisch-Dämonische Verzeichnis Dämlicher Monarchen?«
»Nein!«
»Vielleicht das Apo’kryptische Apo’stroph?«
»Oh, ich weiß es«, beteiligte sich der Novize an dem Ratespiel. »Es ist Madame Elegancias Bilderbuch des erotischen Kochens.«
»N… Woher kennst du dieses Buch?«
»Na was denn nun?« Bruder Schreiber verlor allmählich die Geduld.
»Er hat das Weiße Buch gestohlen.«
Stille folgte. Die Mönche duckten sich und lauschten. Die Gesetze der Dramatik verlangten nach so mysteriös ausgesprochenen Worten eigentlich ein bedrohliches Donnergrollen. Es blieb still. Bruder Bibliothekar räusperte sich verlegen.
»Das Weiße Buch …« Bruder Schreibers Worte gingen im ohrenbetäubenden Getöse des Donners unter. »Himmel noch mal! Also das Weiße Buch …« Es krachte, als ob die Erde entzwei bräche.
»Was ist denn mit dem Weißen Buch?« Novize hielt sich gerade noch rechtzeitig die Ohren zu, bevor erneuter Donner durch das Gebäude hallte, Maus und Mann aus dem Schlaf aufschreckte und kleine Käfer im Flug platzen ließ.
»Verdammt noch mal! Hört doch endlich auf, diesen Titel immer und immer wieder zu erwähnen!«, schimpfte Bruder Bibliothekar.
»Aber was hat es denn mit dem W… dem Nicht-Schwarzen Buch auf sich?«, fragte Novize neugierig. Bruder Bibliothekar versuchte das Pfeifen in seinen Ohren zu ignorieren.
»Es wurde der Bibliothek unseres Ordens vor langer Zeit von der Königin Kreszenzia Ignatia gestiftet. Diese Monarchin hatte eine Schwäche für Dämonologie und Mystik. Was ihr zum einen den Beinamen »Irre Inga« einbrachte, zum anderen dazu führte, dass sie eines Tages urplötzlich verschwand. Es heißt, das W… das Nicht-Schwarze Buch hätte sie verschlungen.«
»Hat man sie je wiedergesehen?«, wollte der Novize wissen.
»Oh ja, man hat. Allerdings auch ziemlich viele Teile von ihr. Und auch an weit auseinander liegenden Orten.«
Bruder Schreiber seufzte. »Wir sollten den Abt von dem Zwischenfall unterrichten. Wie machen wir es diesmal?«
»Wie immer. Wir schicken den Grünling vor – nichts für ungut, Novize – und nachdem sich das wütende Geheul des Abtes wieder gelegt hat, werden wir eine Belohnung auf die Ergreifung dieses Diebes aussetzen.«
»Aber was, wenn er bis dahin das Buch benutzt?«, fragte Novize nervös.
»Nun, das würde uns die Suche wesentlich erleichtern.«
»Ganz recht, Bruder Schreiber. Man müsste einfach nur dem Knall folgen und dann den Krater im Boden suchen, um den sich die meisten Körperteile finden.«
Zusammenfassende Bewertung
Aberwitzig, humorvoll, bizarr, schräg – beste Unterhaltung: Was will man mehr?
Vielleicht schreien jetzt einige, das klänge verdächtig nach Terry Pratchett! Sehr aufmerksam: Recht so! Genau! Tut es!
Na und?
Ich kann nur dringend empfehlen, mal im Stile anderer Lieblingsautoren zu schreiben: Das schult die eigenen Schreibfähigkeiten enorm! Man erweitert seine Ausdrucksmöglichkeiten, lernt neue Zusammenhänge und Wörter kennen, kann vielleicht komplexere oder einfachere Sätze bilden, die dennoch lesbar sind, man lernt reduzieren (sofern es gute Autoren sind) und dem Leser Raum zu lassen … das hilft ungemein, einen eigenen Stil zu finden. Kopieren tun wir eh, ob bewusst oder unbewusst! Es sei denn, wir läsen erst gar nicht …
Die Kritik im Einzelnen
Fluchtgedanken sind von Haus aus dringlich, sonst kämen sie nicht! Insofern kann auf drängenden restlos verzichtet werden. zurück
Würde hier Hufgeklapper oder klappernde Hufe nicht genügen? Obwohl: Eigentlich kann es auch so bleiben, wie es ist! Denn wenn die Wortreichen Brüder schon an klirrendem Glas zu unterscheiden vermögen, ob da jemand versehentlich durchbricht oder absichtlich durchspringt – warum sollen die nicht auch das Geräusch unbeschlagener Hufe von dem beschlagener unterscheiden können? Doch: Es sollte so bleiben, wie es ist, passt einfach zum Stil! zurück
Hier sei ein Vorgriff gestattet (wer sollte es mir auch verbieten, ich kann hier schließlich tun und lassen, was ich will!): Der Novize taucht häufiger auf, verliert dann aber unverhofft seinen Artikel – da wäre Vereinheitlichung angebracht! Ich würde übrigens der artikellosen Variante den Vorzug geben, weil es wie ein Eigenname klingt, was zu all den herrlich-schrägen Übertreibungen und Überraschungen passt! zurück
Nach so vielen Ds missfallen mir die Monarchen: Wie wäre es mit stattdessen mit Despoten? Passte auch besser zu dämonisch – welchselbiges eigentlich weniger mit Monarchen im Allgemeinen zu tun hat und deswegen etwas hilflos in der Luft hängt! Für die gäbe es bessere Möglichkeiten: diaphorisch (=den Unterschied betonend), diaphoretisch (=schweißtreibend), dialogisch usw. – ähm, also, irgendwie verliere ich den Faden! Statt hier rumzuschwafeln, sollte ich mich lieber wieder konzentrieren – der anregenden Lektüre zum Trotz! zurück
Das ist jetzt zu viel! Den Apostroph kann eh niemand sprechen – deswegen zöge ich eine apostrophenfreie Schreibversion vor, vielleicht auch ohne das erfundene apokryptisch: Vielleicht der Apokalyptische Apostroph? (Malte! Jetzt reicht’s!) zurück
Was war bei der Aussprache mysteriös? Ist hier mystisch gemeint? Oder geheimnisvoll? Wurde der Titel geflüstert? Das bedarf der Klärung! zurück
Was ein verrückt-grandioses Bild! Noch nie wurde mir so anschaulich vor Augen geführt, was Schalldruck ist! zurück
Das geht logisch nicht: Man kann nicht die irre Inga ganz sehen und gleichzeitig auch noch in Teilen. Vorschlag: Oh ja, man hat. Allerdings als viele Einzelteile. Und auch an weit auseinander liegenden Orten. zurück
Twitter-Lyrik-Preisträgerin Simone Kremsberger: »Je weniger dasteht, desto weniger lenkt ab«

Simone Kremsberger heißt die Gewinnerin des diesjährigen Twitter-Lyrik-Wettbewerbs von literaturcafe.de und BoD mit richtigem Namen. Sie twittert unter @SalonSimone.
Selbst der Jury des Wettbewerbs ist der Twitter-Name vor der Gewinn-Entscheidung nicht bekannt. Die Teilnehmer-Tweets sind in einer Excel-Tabelle gelistet, die Namen der Einsender ausgeblendet.
Da ist es spannend zu sehen, ob der Gewinner-Beitrag von einem bekannten oder unbekannten Twitterer kommt und was sie oder er sonst noch twittert und wohin ein etwaiger Link im Twitter-Profil führt.
Überraschung diesmal: Im Twitter-Profil @SalonSimone wird fast ausschließlich Lyrik getwittert.
Simon Kremsberger alias @SalonSimone kann sich nun über den gewonnenen iPod touch freuen. Wir wollten mehr über die Gewinnerin 2010 wissen und haben mit ihr gesprochen.
Sexy Buchhändlerinnen: Ein Bericht vom Fotoshooting für den Erotikkalender
 Dürfen sich Buchhändlerinnen nackt fotografieren lassen? Schadet oder nützt es dem Ruf, den sie in der Öffentlichkeit haben? Und werden beim geplanten Erotik-Kalender tatsächlich nackte Brüste zwischen Buchdeckeln zu sehen sein?
Dürfen sich Buchhändlerinnen nackt fotografieren lassen? Schadet oder nützt es dem Ruf, den sie in der Öffentlichkeit haben? Und werden beim geplanten Erotik-Kalender tatsächlich nackte Brüste zwischen Buchdeckeln zu sehen sein?
Tatsache ist: Seitdem das Projekt eines erotischen Fotokalenders mit Buchhändlerinnen als Models angekündigt wurde, wird darüber eifrig diskutiert. Derszeit finden die Shootings für die Monatsblätter statt, und obwohl den Kalender noch niemand gesehen hat, malen sich einige plastisch aus, wie die Fotos wohl aussehen werden. »Hat die junge Buchhändlerin eine andere Art, einen Slip zu tragen?«, will beispielsweise Jörg Sundermeier auf buch-pr wissen.
Nachdem wir das Projekt unlängst auf literaturcafe.de vorgestellt und mit Projektleiterin Simone Pfeifer gesprochen hatten, haben sich zahlreiche Buchhändlerinnen als Model beworben.
Sind Buchhändlerinnen also weniger prüde als die Kritiker des Projekts?
literaturcafe.de wollte es genau wissen und war bei einem der Fotoshootings dabei. Hier ist unser Bericht mit Bildern.
Gewinner-Beitrag des 2. Twitter-Lyrik-Wettbewerbs: Bestes Twitter-Gedicht kommt aus Österreich
Der 2. Twitter-Lyrik-Wettbewerb von literaturcafe.de und BoD ist beendet. Die Jury hat alle eingereichten Beiträge gesichtet und vergibt den Preis für das beste Twitter-Gedicht 2010 an @SalonSimone.
Ausführliche Jurybegründung unter www.twitter-lyrik.de »
Blutrünstiger Klassiker: Stolz und Vorurteil und Zombies
 Was hat den Heyne Verlag geritten, solch hanebüchenen Quark zur deutschsprachigen Ausgabe von Jane Austens »Pride and Prejudice and Zombies« zu schreiben?
Was hat den Heyne Verlag geritten, solch hanebüchenen Quark zur deutschsprachigen Ausgabe von Jane Austens »Pride and Prejudice and Zombies« zu schreiben?
Der Roman sei »die alternative Version des großen Klassikers«, die man »in den Archiven der Universität Oxford entdeckt« habe. Jane Austens Co-Autor Seth Grahame-Smith habe das Werk abgetippt, und seither habe man nicht mehr von ihm gehört. Ein Nachwort-Geschwurbel von »Prof. Waldemar Knochen, Universität Leichburg« und fiktive Anzeigen für weitere Klassiker wie Thomas Manns »Der Zombieberg« sind im Anhang zu finden.
Will der Verlag mit diesem Unsinn das die deutsche Ausgabe interessanter machen? Das ist reichlich misslungen und schadet dem Werk. Denn dieses ist interessant genug.
Tatsächlich hat Seth Grahame-Smith – Jahrgang 1976 und wohlauf – Jane Austens Klassiker mit blutigen Zombie-Szenen durchsetzt. Was nach einer literarischen Freveltat klingt, funktioniert erstaunlich gut.
Textkritik und SchreibStar: »Disaster Recovery« eines Romananfangs
 Wenn in der EDV-Abteilung – die heute IT-Abteilung heißt – etwas kaputt geht, dann wird ein »Disaster Recovery« durchgeführt. Es ist der Moment, in dem man hofft, dass Datensicherungen oder Ersatzgeräte vorhanden sind, um rasch wieder funktionsfähig zu sein.
Wenn in der EDV-Abteilung – die heute IT-Abteilung heißt – etwas kaputt geht, dann wird ein »Disaster Recovery« durchgeführt. Es ist der Moment, in dem man hofft, dass Datensicherungen oder Ersatzgeräte vorhanden sind, um rasch wieder funktionsfähig zu sein.
»Disaster Recovery« lautet der Titel des Romans, dessen Anfang sich unser Textkritiker Malte Bremer angesehen hat. In Kooperation mit der Website SchreibStar.tv zum neuen Roman »Möchtegern« von Milena Moser, bespricht Malte Bremer insgesamt sechs Romananfänge. Nach zwei überaus gelungenen Anfängen, ist unser Textkritiker diesmal nicht ganz so zufrieden. Schuld daran sind unter anderem »quengelnde Rotorengeräusche«.
Bis Sonntag, 16. Mai 2010, konnten Romananfänge eingeschickt werden, denn nun liegen genügend Anfänge vor, aus denen Malte Bremer noch drei auswählen wird. Im vollen Gange ist noch das Trainingscamp mit den Schreibaufgaben aus dem Roman »Möchtegern«. Die aktuelle Kreativaufgabe lautet: »Ihre Figur verliert vier Tage. Wo? Mit wem? Warum?«
Zur Textkritik von Malte Bremer auf SchreibStar.tv »
Textkritik: Disaster Recovery – Romananfang
Die Nacht hatte er mit ›Nardil‹ überstanden -, verfügte bezüglich Pillen über die freie Auswahl, denn Mutters Medikamentenbestand war schier unerschöpflich.
Und genau deswegen war sie nicht da, als der von ihm erwartete Wagen vorfuhr, kurz hupte, sondern in einem Sanatorium in der Schweiz, einer Art Irrenhaus, das er sich wie den von Thomas Mann beschriebenen ›Zauberberg‹ vorstellte, wenn er an sie dachte; er dachte täglich an sie.
»Einen schönen Gruß von Ihrem Vater, Herr Rausch«, sprach ihn einer der beiden schwitzenden Männer in grauer Uniform mit dem Berliner Bären auf dem Oberarm des Anzugs an, – und blies säuerlichen Atem aus, » … er lässt sich entschuldigen, er hat …«
»Schon gut«, entgegnete Felix schnell, denn allzu oft hatte er die mit säuerlichem Atem vorgetragenen Ausflüchte, seinen Vater betreffend, schon verarbeiten müssen, – hörte den Pirol im Garten rufen, der wohl neben der Grube saß, um in der vom Gärtner eben frisch aufgeworfenen Erde nach Würmern zu suchen.
»Schon gut, – und bringen Sie die Kiste bitte gleich in den Garten!« hinkte er den beiden Männern vorweg.
Einer vorwärts-, der andere rückwärtsgehend folgten ihm die Männer, einen weißen Kasten tragend, auf dem in schwarzen Druckbuchstaben ›Eigentum Gerichtsmedizin Stadt Berlin‹ stand, – in dem sein Hund lag.
Seine Schmerzen, besonders die im Fuß, waren heute fast unerträglich, somit zwang er die Männer hinter sich zur Langsamkeit. Trotzdem stöhnte einer von denen vernehmlich, so, als wenn die zu tragende Last nur schwer zu bewältigen sei.
»Bitte direkt neben die Grube…«, als der aufgescheuchte Pirol das Weite gesucht hatte, »und legen Sie den Hund gleich in das Grab«, als die Männer den Deckel vom Kasten offen hatten.
»Machen wir, Herr Rausch!«, erwiderten die Männer unisono, öffneten die Kiste, wickelten den toten Hund aus der Plastikplane und ließen ihn behutsam in die Grube gleiten.
»Meinen Sie, das ist tief genug?«, fragte der Wortführer der Beiden.
»Wegen der wilden Tiere?«, wollte Felix wissen.
»Ja. Schweine gibt es hier genug, – und die fressen alles!«
»Stimmt. Schweine gibt es genug … aber ich habe Vorsorge getroffen!«
»Eine Grabdecke -, was?«
»Ja, so was Ähnliches.«
»Dann ist es ja gut«, als die Beiden, jeder mit der Hälfte des Eigentums der Stadt Berlin in Form des weißen Kastens in Händen, den Garten verließen.
Am Tor angekommen steckte er ihnen zwanzig Euro zu.
»Das wäre aber…«
»Nehmen Sie schon …; auf Wiedersehen!«
Das Motorengeräusch des Transporters der Gerichtsmedizin war verebbt, lediglich der saure Atem der Beiden hing noch in der Luft, als er am Grab seines Hundes stand und still zu weinen begann.
Wenig später trocknete er seine Tränen mit dem Jackenärmel, legte sich bäuchlings vor das Grab und begann, das Spielzeug vom Hund um dessen Körper herum zu dekorieren und Rosenblätter in der Grube zu verteilen. Über all das breitete er eine Samtdecke aus, und als er gerade mühsam wieder stand, um mit dem an der Seite aufgeworfenen Sand die Grube zu verschließen, quengelten sich Rotorengeräusch in seine Trauerzeremonie.
Suchend blickte er in den Himmel und sah ihn.
Ein ansonst weißer Hubschrauber mit einem roten Kreuz kreiste nicht weit weg vom Haus in ca. einhundert Metern Höhe. Und wie er das Bild in sich wirken ließ, dem Klappern der Rotoren nachspürte, erklang Musik von Stockhausen in ihm, deren Töne rhythmisch-ekstatisch seine Arme und Beine zucken ließen.
Fast unmittelbar war er Streicher in einem Quartett, war das Quartett, befand sich mitten in diesem hüpfenden Aspekt der Symphonie – als schaufelnder Bauarbeiter, der die Löcher der Welt mit Sand verschloss.
Er war eins mit dem Piloten des Helikopter, dem Tontechniker, mit den diversen Menschen an den Fernsehübertragungsgeräten.
Befand sich im Hörsaal der Musikhochschule, war Macher an vier TV-Geräten, Publikum und Lautsprecheranlage, eins mit den Mischpulten, dem Moderator, war Mikrophon, Dirigent, der den Klang der Instrumente einfügte, die letztlich lauter als die Rotorblätter der Hubschrauber waren. Lauter als er, der weinend aus genau einhundert Metern Höhe und eine halbe Stunde lang den Grund der Erde sehen konnte. Der bemerkte, wie sich das Leben im Tod an seinem Maul festfraß und dort verkrustete -, wie die Zeit seines Daseins mit dem Hund, diesem über alles geliebten Tier, zu Nichts gerann.
Letztlich weckte ihn irgendwann imaginärer Applaus -, einer heftigen Art von Morgenkühle gleich – und der aggressive Warnruf des Pirol, dessen wiederholtes djick-jick …
All das holte ihn aus dem Trance in die Wahrheit des Tages, in den Augenblick, in die ewige Gedankenflut, wie es hatte geschehen können, dass er nun ein Krüppel war, dass es ab nun immer so ist, wie es ist und bliebe. Er alleine – ohne Hund.
Offen blieb, wie es dazu kommen überhaupt konnte.
Zusammenfassende Bewertung
Eigenwilliger Umgang mit Gedankenstrichen und bemühte Bilder machen noch lange keinen guten Roman.
Zunächst beginnt dieser Text gar nicht schlecht – aber spätestens bei den quengelnden Rotorengeräuschen hätte ich die Stirn gerunzelt, und bei der ins Nichts gerinnenden Zeit hätte ich das Buch entnervt beiseite gelegt. Da wird nicht mehr erzählt, da wird geschwafelt missioniert – wofür auch immer …
Die Kritik im Einzelnen
Vorbemerkung: Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler wurden stillschweigend verbessert – auch dafür sind Lektoren da! Es ist zudem keine bewusst eigenwillige Zeichensetzung festzustellen (wie etwa bei Arno Schmidt).
Der Titel gibt zunächst ein Rätsel auf: Warum muss er auf englisch sein? Was drückt er aus, das auf Deutsch nicht eindeutiger hätte gesagt werden können? Mein Collins-Wörterbuch bietet unterbreitet mehrere Vorschläge: Wiederfinden – Zurückbekommen (was bereits ein erheblicher Unterschied ist!) – Wiedererlangung – Bergung – Gewinnung – Eintreibung – Ersatz. Fein! Wie wäre es mit einem Titel, der da lautete »Esatzkatastrophe« oder »Katastrophenersatz«? Verstünde jeder …
Nardil ist ein in Deutschland wegen gravierender Nebenwirkungen nicht zugelassenes Antidepressiva, warum man das in der Nacht braucht, weiß ich nicht.
Dass nach überstanden ein Gedankenstrich mit anschließendem Komma folgt, scheint so etwas wie ein Stilmerkmal dieses Romans sein zu sollen, ohne dass es mir einleuchtet, eben so wenig wie die Variante Komma-Gedankenstrich: Ich halte diesen Strich für überflüssig, wenn es gar nix zu denken gibt.
Auf ein er vor verfügte würde ich hingegen nicht verzichten, denn der Satz beginnt nicht mit er, sondern stellt es nach (Die Nacht hatte er …); somit ist die Logik im Satzbau nicht gewährleistet, was beim Lesen irritiert. zurück
Das ist ausgesprochen gut gelungen, denn hier ist der Leser gefordert mitzudenken: Des Protagonisten Mutter hat wohl zu exzessiv mit Medikamenten experimentiert! zurück
Mmh – da Herr Rausch wohl kaum Uniformstoff zu durchschauen vermag, ist hier des Anzugs überflüssig. zurück
Warum wird hier ein Abschnitt gemacht statt eines Absatzes? Das Gespräch geht doch unmittelbar weiter, und was Neues kommt auch nicht! zurück
Dass jemand Sprache hinkt, müffelt sehr nach gewollter Originalität! Besser wäre ein Punkt und ein neuer Beginn: Er hinkte (…) vorweg. zurück
Hier ist einer dieser sehr irritierenden Gedankenstriche! Würde der Satz lauten: Einer vorwärts, der andere rückwärts gehend folgten ihm die Männer, einen weißen Kasten tragend – ›Eigentum Gerichtsmedizin Stadt Berlin stand in schwarzen Druckbuchstaben darauf‹ –, in dem sein Hund lag, dann hätten die beiden einen Sinn. Aber der eine allein?
Zu begrübeln bleibt auch, warum ein Hund in der Gerichtsmedizin untersucht wird – aber vielleicht wird das ja im Roman deutlich zurück
Dieses trotzdem will mir nicht einleuchten: Wenn etwas schwer ist und man zum langsamen Gehen gezwungen wird, dann ist das überaus lästig – man will die Last schließlich loswerden, da darf man doch stöhnen?! zurück
Dieser Satz schwebt grammatisch im Leeren, da sollte vor bzw. nach der wörtliche Rede ein »Er sagte« bzw. »sagte er« eingefügt werden. zurück
Erneut gibt es hier einen unverständlichen Abschnitt statt eines Absatzes! zurück
Hä? Hätte er ihnen denn am Tor auch dann Geld zustecken können, wenn weder er noch sie dort angekommen wären? Alternativ: Wie wäre es beispielweise mit einem Gran mehr Präzision, das will doch der Leser, sonst blickt er doch nicht, was da eigentlich los war: Am Tor an- und anschließend ohne Bremsgeräusche, da zu Fuß, zum Stillstand gekommen, einen zusammengefalteten 20-Euro-Schein dem inzwischen geöffneten Geldbeutel entnommen gehabt habend und ihn nach beidhändiger Entfaltung mit der rechten Hand zwischen Daumen und innenhandwärts gekrümmtem Zeigefinger … (und so weiter und so fort et cetera pp ad infinitum …): Nein! Am Tor überreichte er! Und fertig! zurück
Ganz schlechter Stil, gemeinhin auch »Nominalstil« oder treffend-bösartig »Beamtendeutsch« genannt: Dass die Uniformträger nicht von der Heilsarmee sind, wissen wir, und auch, dass sie zur Stadt Berlin gehören. Warum also nochmals die Gerichtsmedizin bemühen? zurück
Dass da noch sauerer Atem hängt, ist doch eigentlich zu erstaunlich, als dass es durch ein lediglich abqualifiziert werden müsste: Hinfort mit diesem Wort! zurück
Um Ulm herum – jaja, aber es geht hier nicht um Ulm, auch nicht um Zungenbrecher oder Wortspiele: das Spielzeug vom Hund ist nichts anders als Hundespielzeug, und man dekoriert nicht um etwas herum, sondern etwas; aber man kann Hundespielzeug um den Körper drapieren oder verteilen – drapieren wäre feierlicher. zurück
Da hakt es gleich mehrfach: Singular oder Plural – aber wenn, dann bitte beides: entweder quengelten sich Rotorengeräusche oder quengelte sich Rotorengeräusch; ich tendierte zu Letzterem – wäre da nicht die unglückliche Vermanschung von Rotorengeräusch mit quengeln: Was dieses aufdringlich-regelmäßige Knallen und Fauchen mit nörgeln oder weinerlich oder jammern zu tun haben soll, zu ergründen vermag ich es nicht! Nachvollziehbar wäre etwa: drängte (drängelte, presste, quetschte …) sich Rotorengeräusch … zurück
Hier haben wir ein Musterbeispiel für einen völlig überflüssigen Satz! Wer im Freien einen Hubschrauber hört, blickt automatisch nach oben; dass oben der Himmel ist, weiß jedes Kind; dass wir als genetisch bedingte Schlechthörer den Hubschrauber nicht sofort lokalisieren können, also suchen müssen, ist so trivial wie wahr. Was also soll dieser Satz? Welche Informationen liefert er uns? Welch sprachliche Raffinesse weist er auf? Welche neue Bilder prägt er? Wer würde ihn vermissen, stünde er gar nicht da? Eben! Streichen! zurück
Das ist ein Dialektwort – Da ansonsten aber hochdeutsch geschrieben wird, sollte es ansonsten heißen. zurück
Wozu dient diese Höhenangabe? Kein Mensch kann sich das vorstellen, da ihm Vergleichsgrößen fehlen – es ist zudem sowas von überwurschd, ob es 100 oder 150 oder 215,45 m sind! Warum darf der Rotorträger nicht einfach hoch über dem Haus kreisen? zurück
Wo ist das bemühte quengeln geblieben? Wieso droht jetzt der Absturz, da die Rotorblätter einen Abflug machen wollen, schließlich klappern sie bereits, das bedeutet doch: Da hat sich was gelöst oder gelockert? Himmel: Hilf! zurück
Bislang gab es nur einen Hubschrauber – wo kommen die anderen her? zurück
Vorhin waren es etwa einhundert, jetzt sind es genau: Wie ist das zu verstehen? Und wozu soll man das verstehen wollen? zurück
Wieso frisst sich das Leben am eigenen (=seinem) Maul fest? Und was hat das mit der Musik zu tun? zurück
Zum gloriosen Finale dieser Bilderflut wird jetzt gewaltig auf die Kitsch-Tube gedrückt: Die Zeit seines Lebens gerinnt zu Nichts! Leben – Tod – Zeit – Nichts – Raum – Welt: All diese nichtssagenden Schwafelhülsen, die Tiefsinn im Flachwasser vorgaukeln. Ei was nicht gar: Damit wäre Herr Rausch ja mausetot, wäre er ins Nichts geronnen – dennoch geht die Geschichte weiter. Dieses Gesumse hätte der Erzähler sich und dem Leser ersparen können und kann es immer noch durch einfaches Streichen! zurück
So steht’s zumindest in Wikipedia; aber es geht um was anderes, nämlich um den aggressiven Warnlaut: das ist 1er! Das sollte dann heißen: (…) Warnruf des Pirols, dieses djick-jick. zurück
Die Trance ist eindeutig weiblich! Folglich holte ihn all das aus der Trance. zurück
Da ist noch so ein beliebtes hohles Kitschwort: ewig! Was soll das sein? Es bedeutet ohne Anfang und ohne Ende, also etwas, was wir mit unserem vorprogrammierten Ursache-Wirkung-Denken uns überhaupt nicht vorstellen können, und damit ist es letztlich sinnlos. Aber halt schööön kitschig! zurück
Was ist der große Unterschied zwischen »immer so sein« und »bleiben«? Sehen Sie, ich weiß es auch nicht! Warum aber wird dann beides gesondert als etwas Besonderes aufgezählt? Sehen Sie: Ich auch nicht! zurück
Warum nun diese verdrehte Satzstellung? Offen blieb, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Warum muss dieses harmlose Sätzchen so verbogen werden? Wobei mich zusätzlich dieses Präteritum blieb stört: Der Satz kommt mir vor wie ein Erzählerkommentar, und wenn dem so wäre, sollte hier Präsens stehen, da der aktuelle Leser angesprochen und ihm mitgeteilt wird, dass jetzt der Grund für Hundetod und Herrn Rauschs Krüppeldasein erzählt werden wird, wir uns also eigentlich am Ende des Romans befinden. zurück
Mediacampus Frankfurt: Fachschullehrgang nimmt Stellung zum offenen Brief der Schüler
 Die Diskussion über die Qualität und Ausrichtung der Ausbildung auf dem Frankfurter Mediacampus (früher: »Schulen des Deutschen Buchhandels«) geht in eine weitere Runde.
Die Diskussion über die Qualität und Ausrichtung der Ausbildung auf dem Frankfurter Mediacampus (früher: »Schulen des Deutschen Buchhandels«) geht in eine weitere Runde.
Zunächst verfassten die Schüler des 162. Kurses einen offenen Brief an die Geschäftsleitung, in dem sie die mangelhafte Branchenkenntnis externer Referenten, den Weggang kompetenter Lehrkräfte und den einseitigen Schwerpunkt der Ausbildung auf den »Neuen Medien« beklagen. Auf literaturcafe.de wurde über diesen Brief heftig diskutiert.
Jetzt melden sich in einer Stellungnahme die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 33. Fachschule
zu Wort. Sie haben Verständnis für die Verunsicherung und die Ratlosigkeit der Schüler und bemängeln die fehlende Kommunikation auf dem Campus. Es werden, so die Verfasser, »Worthülsen, wie E-Commerce, Fair Play, Team Work und Longlife Learning aufgeblasen, ohne diese mit Inhalten zu füllen«.
Anders als die Schüler, denen Kritiker mangelnden Praxisbezug und einen naiv-konservativen Blick auf das Buch vorwarfen, kann dies von der 33. Fachschule nicht behauptet werden. Hier handelt es sich um ausgebildete Buchhändlerinnen und Buchhändler, die in diesem Aufbaulehrgang unter anderem die Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten sowie die Personal- und Mitarbeiterführung lernen sollen.
Dokument: Offener Brief an die Geschäftsleitung des mediacampus Frankfurt von den Schülern des 162. Kurses
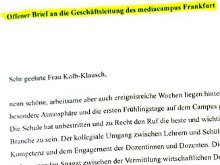 Früher hieß er »Schulen des Deutschen Buchhandels«, heute ist er zum »Mediencampus« geworden: Der Ort auf den grünen Hügeln zwischen Seckbach und Bergen-Enkheim bei Frankfurt. Viele Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland haben hier während ihrer Ausbildung die Berufsschule besucht.
Früher hieß er »Schulen des Deutschen Buchhandels«, heute ist er zum »Mediencampus« geworden: Der Ort auf den grünen Hügeln zwischen Seckbach und Bergen-Enkheim bei Frankfurt. Viele Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland haben hier während ihrer Ausbildung die Berufsschule besucht.
Schon die Namensänderung zeigt, dass man sich hier mehr der Zukunft zuwenden möchte. Der Buchhandel muss auf die Digitalisierung auch in seiner Ausbildung reagieren.
Doch wie dies geschieht, scheint bei den Auszubildenden nicht unbedingt auf Zustimmung zu stoßen. Mit einem offenen Brief wenden sich die Schüler des 162. Kurses, die heute ihre Zeugnisse erhalten und den Campus verlassen, an die Geschäftsleitung der Schule.
Ein Brief der Außenstehende verwundert.
Wir verlosen 10×2 Kinokarten für »Die Eleganz der Madame Michel«
 Am kommenden Donnerstag, dem 6. Mai 2010, läuft in den deutschen Kinos der Film »Die Eleganz der Madame Michel« an. Regisseurin Mona Achache schrieb das Drehbuch frei nach dem Bestseller-Roman »Die Eleganz des Igels« von Muriel Barbery.
Am kommenden Donnerstag, dem 6. Mai 2010, läuft in den deutschen Kinos der Film »Die Eleganz der Madame Michel« an. Regisseurin Mona Achache schrieb das Drehbuch frei nach dem Bestseller-Roman »Die Eleganz des Igels« von Muriel Barbery.
Im Mittelpunkt dieses französischen Films stehen drei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten und die im gleichen Haus wohnen: die elfjährige Paloma, die beschlossen hat, sich an ihrem 12. Geburtstag umzubringen, da sie ein Erwachsenenleben im Luxus erbärmlich findet, der geheimnisvolle Japaner Kakuro Ozu, der eines Tages in das Haus einzieht – und Madame Michel, die Concierge des eleganten Pariser Wohnhauses. Madame Michel ist so, wie man sich die typische französische Hausmeisterin vorstellt: mürrisch und verschlossen. Doch man ahnt es: das Schicksal führt die drei zusammen und verläuft unerwartet.
In den französischen Kinos war der Film ein großer Erfolg und beim Internationalen Filmfestival in Kairo wurde er mit drei Preisen ausgezeichnet, darunter der für die beste Regie.
Mit freundlicher Unterstützung des Senator Film Verleih verlosen wir 10 mal 2 Kinogutscheine für »Die Eleganz der Madame Michel«. Die Gutscheine können in jedem Kino, in dem der Film gezeigt wird, eingelöst werden.