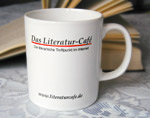Das war's: Die besten Berichte und unsere Gästegalerie! Das war's: Die besten Berichte und unsere Gästegalerie!Unsere Beobachtungen von der 53. Frankfurter Buchmesse (10.10.-15.10.2001) - Für einen Text gab es unsere Literatur-Café Tasse |
| »Ganz interessante Neuansätze« Samstagmorgen auf der Buchmesse 2001 am Stand des Deutschen Taschenbuch Verlags: Gleich sollen die Preise des Wettbewerbs »Literatur.digital 2001« verliehen werden, der vom Verlag zusammen mit T-Online ausgeschrieben wurde. Schüchtern und aufgeregt warten die Gewinner auf den großen Moment. Ihre Namen sind bislang auch in der digitalen Literaturszene unbekannt. Viele haben sich im Rahmen des Wettbewerbs zum ersten Mal mit der Verbindung von Literatur und digitalen Medien beschäftigt - und waren überrascht, zu den Preisträgern zu zählen.
Den Veranstaltern ist auf jeden Fall eine hohe Professionalität bei der Durchführung und Organisation des Wettbewerbs zu bescheinigen. Unter allen Einsendungen wurden 20 vorab termingerecht ausgewählt und sowohl eine Jury wie auch die Besucher der Website durften hieraus drei Gewinner küren. Die Publikumsabstimmung fand nicht öffentlich statt, was - wie damals auch der Pegasus zeigte - häufig zur Manipulation der Abstimmung führt. So blieben die Stimmzahlen geheim, allerdings war zu hören, dass der Abstand zwischen den ersten vier Plätzen sehr knapp gewesen sei. Ein Interview mit dem Juryvorsitzenden Roberto Simanowski
Das Literatur-Café: Der neue Literaturpreis von dtv und T-Online - ein bisschen in der Tradition des Pegasus der ZEIT - ist nun zum ersten Mal verliehen worden. Lässt sich an den aktuellen Beiträgen eine Veränderung feststellen? Ist die Qualität anders oder besser geworden? Roberto Simanowski: Die Beiträge sind anders auf alle Fälle, weil der Wettbewerb jetzt ja einige Jahre später stattfindet. Es sind viele Flash-Sachen dabei gewesen, und auch die Hypertexte, die Möglichkeiten, die man mit kombinatorischer Dichtung machen kann, sind andere. Das Literatur-Café: Es gab ja durchaus eine Abweichung zwischen dem Jurypreis und dem Publikumspreis, bei dem die Websurfer abstimmen konnten. Die jeweiligen drei Gewinner sind absolut unterschiedlich. Gibt es hierfür eine Erklärung? Roberto Simanowski: Ich würde sagen, dass das Publikum nach anderen Kriterien entscheidet. Vielleicht eher nach Gefälligkeit oder ob ein Beitrag Spaß macht. Und da hat zum Beispiel ein Werk wie Apfel eine große Chance, das bei uns auch in der engeren Wahl war, schließlich aber keinen Preis bekam, weil wir dann doch fanden, dass es nur eine Illustration eines Textes war, der auch gesondert vorlag. Dadurch entsprach das nicht mehr unseren Kriterien, dass ein Werk aus dem Medium heraus produziert wird. Es wurde eher in das Medium hinein produziert. Das ist ein Kriterium, das für diesen Unterschied zwischen Publikumsentscheidung und Juryentscheidung steht. Das Literatur-Café: Kann man sagen, dass es sich hier wie im »normalen« Literaturbetrieb abzeichnet, dass die Jury eher Beiträge auszeichnet, die einen intellektuelleren Zugang erfordern, den man vielleicht nicht gleich auf dem ersten Blick erkennt, und das Publikum eher die Beiträge bevorzugt, die visuell ansprechen und zum Klicken animieren. Roberto Simanowski: Prinzipiell würde ich sagen ja. Allerdings sind die von der Jury ausgezeichneten Knittelverse durchaus auch ein Werk, das einen Klickspaß vermittelt. Das ist intellektuell nicht sooo fordernd. Quadrego ist von den Texten her und von dem was da versteckt ist schon anspruchsvoller, das stimmt. Für die Knittelverse trifft das nicht zu und auch für die Callas-Box nicht, denn die Story, die da erzählt wird, ist eigentlich ziemlich verständlich, ziemlich zugänglich. Das Literatur-Café: Gerade bei den Knittelversen herrschte bei vielen etwas Unverständnis warum dieser Beitrag - zusammen mit Quadrego - den ersten Preis bekam. Auf den ersten Blick, würde man ihn eher als »ganz nett« einstufen. Was waren die Gründe für die Jury, diesen Beitrag zu prämieren? Roberto Simanowski: Ich hab versucht das schon in der Laudatio ein bisschen zu beschreiben. Die Idee, dass das Bild plötzlich narrativ wird, dass sich unter ihm auf verschiedenen Ebenen Texte verstecken, ist hier sehr kompakt und ohne große Erklärungen und Schnörkel umgesetzt sind. Uns hat die Kompaktheit überzeugt, mit der diese Idee durchgeführt wird. Das Literatur-Café: Es soll erfreulicherweise einen weiteren Wettbewerb im nächsten Jahr geben. Lässt sich denn jetzt schon sagen, ob es Veränderungen bei den Bedingungen geben wird? Diesmal war ja eindeutig digitale Literatur gefragt, das Internet spielte weniger eine Rolle. Ist es zum Beispiel denkbar, dass Links ins Netz zugelassen werden? Roberto Simanowski: Diese Einschränkung muss man aus den Interessen der Veranstalter oder zumindest des Verlags heraus verstehen. Man orientiert sich wenig auf kooperative Werke, auf die richtige Netzliteratur, was dann ja meistens auch unabgeschlossene Projekte sind. Wir wissen, dass es da mehr um den Aspekt der sozialen Ästhetik, um den Vorgang des kollaborativen Schreibens an sich geht, um die Performance, weniger um die Texte. Die Qualität ist dann immer sehr unterschiedlich, weil dort ja jeder mitschreiben kann. Sie sind eher unter dem Aspekt der »kooperativen Ästhetik« interessant, wie das Christiane Heibach beschreibt. Problematisch ist das aber für einen Wettbewerb, bei dem man vermitteln will, was man an konzentrierter Arbeit als Autor oder als Team leisten kann, wobei das immer mehr auf ein Team hinausläuft. Das ist bei den Netzwerken nicht gegeben. Deswegen liegt der Fokus bei einem solchen Wettbewerb nicht auf diesen Werken. Wäre das der Fall, so könnte man zeigen, was das Netz an neuen Kommunikationsformen bringt, aber nicht, wie sich Text mit neuen ästhetischen Ausdrucksformen verbindet. Das ist sehr schwierig zu klären, außer bei solchen Werken wie 23:40, bei dem das Konzept natürlich so interessant ist, dass man auch schwächere Texte, die dort eingegeben werden, hinnimmt. Das ist dann eher Netzkunst, Conceptual Art, weil es hier mehr um das Konzept der Installation geht und weniger um die Texte. Da ist es schwierig, noch die Unterscheidung zwischen Netzliteratur und Netzkunst zu treffen. Die ist eigentlich so noch nicht ausgearbeitet; weder von Theoretikern der Netzliteratur noch der Netzkunst. Das Interview führte Wolfgang Tischer
13.10.2001, Buchmesse Frankfurt |
|
| |



 Wir haben uns nach der Preisverleihung mit dem Juryvorsitzenden Roberto Simanowski über den Wettbewerb und die Ergebnisse unterhalten.
Wir haben uns nach der Preisverleihung mit dem Juryvorsitzenden Roberto Simanowski über den Wettbewerb und die Ergebnisse unterhalten.