
Der Autor Ruben Philipp Wickenhäuser blickt auf seine 20 Jahre als Autor zurück. Von den ersten fieberhaft niedergeschriebenen Geschichten als Siebzehnjähriger, die seitens der Verlag nur Absagen brachten, bis hin zu ersten Erfolgen und der Gründung einer großen Autorenvereinigung.
Jedoch ist es auch heutzutage nicht leichter geworden, einen soliden Verlag zu finden. Wickenhäuser analysiert in seinem Beitrag, woran dies liegen könnte.
1991: Sechs dicke braune Umschläge. Jeder davon ein Anschreiben und 200 Seiten enthaltend, sauber in Times New Roman und zweizeiligem Abstand gedruckt. Gleichzeitig auf den Weg gebracht an sechs Verlage von einem Siebzehnjährigen, der aus unerfindlichen Gründen spürte, dass die Indianergeschichte, die er da von seinem handschriftlichen Manuskript hatte abtippen lassen, veröffentlicht werden müsse. Eine Indianergeschichte, die in einem halben Jahr in fieberhafter Eile niedergeschrieben worden war: zuvor war das Interesse am Schreiben nicht besonders groß gewesen. Keine Kurzgeschichten, Gedichtchen, Romananfänge oder dergleichen waren der Sturmflut vorangegangen, die den Schüler aus dem Nichts heraus überwältigt hatte.
Sturmfluten alleine sind kein Garant für Erfolg, im Gegenteil. Und also kamen alle sechs Sendungen nach mehr oder weniger langer Zeit wieder zurück, nur um sofort in neue Umschläge gesteckt und an weitere Verlage versendet zu werden. Und landeten etwas später wieder im heimischen Briefkasten. Nur um aufs Neue auf den Weg gebracht zu werden …
Nein, die wundersame Geschichte der Lancierung des Bestsellers eines hippen Jungautoren ist dies nicht. Vielmehr ein Bericht über den ganz gewöhnlichen Weg eines ganz gewöhnlichen Schriftstellers.
42 statt 16 Seiten pro Datei: Ein Fortschritt

E-Mail? Webseiten? Waren damals noch so gut wie unbekannt. Und der erste Computer, der um des Schreibens Willen ein Jahr später gekauft wurde, verlangte nach ganzen 16 Seiten das Abspeichern in einer neuen Datei. Nach der Verdoppelung des Arbeitsspeichers auf ein stattliches Megabyte wurden daraus immerhin 42 Seiten. Noch 1991 war die Schreibmaschine ein gewöhnlicher Anblick, und handschriftliches Schreiben üblich. Während Schreibmaschinen heutzutage wohl kaum noch als Alternative zum Computer gehandelt werden, ist es die Handschrift durchaus: Da ist nicht allein der Umstand, dass man unabhängig von klobiger oder winziger Technik, von Batterieständen, so neugierigen wie argwöhnischen Betriebssystemen und ohne Angst vor Wasserschäden schreiben kann, wann und wo man möchte; auch das Haptische der Handschrift sollte nicht unterschätzt werden, wenn es um das Eintauchen in die Abenteuer der eigenen Phantasie geht – »Fernsehen im Kopf«, wie ein Lehrer als Einleitung zu einer Lesung sagte.

Der labyrinthische Weg zur Erstveröffentlichung
Und auch etwas anderes hat sich in der schriftstellerischen Arbeit kaum geändert: Die Zurückhaltung der Verlage. Mag sein, dass die Masse an Manuskripten durch das Aufkommen von E-Mail und Textverarbeitung noch zugenommen hat. Aber schon vor 25 Jahren war es ein schwer erreichbarer Traum, seinen Text tatsächlich veröffentlicht zu bekommen, und etwas mehr als ein Formschreiben als Ablehnung war die Ausnahme. Immerhin wurden die Texte zumeist noch zurückgeschickt, wodurch der vielleicht enttäuschte, aber dafür doch dankbare Autor sie direkt neu versenden konnte.
Hartnäckigkeit gehört zur notwendigen Grundausstattung all derer, die weder das Glück eines verlegerischen Lottogewinns noch guter Kontakte haben: Ein Text, der nicht veröffentlicht wird, findet keine Leser. Aber nur Leser können einen Text zum Leben erwecken, und das Leben des Textes ist wohl das ultimative Ziel für Schriftsteller. Wie oft das Skript auch immer zurückkommt, es muss wieder raus in die Wildnis, es gilt, das Glück aufs Neue zu versuchen. Auch wenn es häufig eine Suche ohne Erfolg bleiben wird.
So erging es auch dem ersten Text des Verfassers Anfang der Neunziger: Alle Mühen schienen vergebens. Doch da war es bereits für eine Umkehr zu spät. Die Sucht des Schreibens hatte sich fest eingenistet, und also folgte wurde später eine Sammlung von Erzählungen zur Post gebracht. Auf diese wiederum wurde eine Lektorin aufmerksam und fragte nach, ob sich aus einer davon nicht ein Roman machen ließe.
Und wieder geschah etwas, was gerade heute allzu vertraut klingt. Ehe es zum Vertragsschluss kam, änderte der Verlag seine Programmplanung und schloss die relevante Sparte Jugendbuch. Damit war die Aussicht auf eine Veröffentlichung mit einem Schlag dahin … oder wäre es gewesen. Denn wie es sich herausstellen sollte, war dies ein Glücksfall: Die Lektorin wechselte zu einem wesentlich größeren Verlag – und schaffte es, den Text dort als »Hit« im Jugendbuchprogramm unterzubringen. Damit nicht genug: Die Indianer-Erzählung, die sie zu einem Roman ausgeführt haben wollte, bediente sich ähnlicher Motive wie das erste Romanmanuskript. So konnte das erste Skript wenn auch nicht als Steinbruch, so doch als Inspiration dafür dienen, fünf Jahre nach der ersten Versendung einem Jugendroman zum Licht der Buchmesse zu verhelfen, im Hardcover mit Schutzumschlag und auf starkes samtenes Papier gedruckt, mithin das Schönste, was sich ein Autor an Ausstattung wünschen kann. Mehr noch: Auf der gleichen Buchmesse wurde von einem anderen Verlag das erste Sachbuch des Verfassers vorgestellt, eine Sammlung für indianische Spiele, die sowohl akademischen, als auch praktisch umsetzbaren Anspruch hatte. Ein paar Lesungen folgten, die jedoch keine »Wasserglasblubbereien« werden sollten, wie eine Rundfunkredakteurin Autorenlesungen einst zu bezeichnen wagte: Dias erschlossen das Leben der Indianer gestern und heute. Als besonders spannende Dreingabe gab es Pfeile, Mokassins, eine Steinkeule und vieles mehr zum Anfassen, was von besonders peniblen Indianer-Hobbyisten detailgetreu nachgebildet worden war.
Unterm Strich also nach fünf Jahren ein traumhafter Start für einen frisch gebackenen Autor – noch dazu für einen, der keinerlei Interesse an der marktgerechten Ausrichtung seiner Bücher hatte. Der Traum vieler Schreibender, ein Buch in einem richtigen Verlag herauszubringen, war für mich in Erfüllung gegangen.
Ein Buch garantiert weder wirtschaftlichen Erfolg, noch weitere Veröffentlichungen
War dies nun also der Beginn einer glanzvollen Karriere, voller Glamour und jenseits aller Geldsorgen? Nicht ganz. Hätte ich Interesse daran gehabt, popliterarisch das Pickelausquetschen zu glorifizieren, dann wäre ich vielleicht in jenes Rampenlicht geraten, das als Trägerstrahl für Talkshows, somit für Werbung, somit für weitere Bücher zum Thema dient. Da mich dies aber bedauerlicherweise gar nicht interessierte, sondern ich vielmehr einen gewissen akademischen Anspruch wenn nicht erfüllte, so doch wenigstens an mich stellte, blieb jener Aufstieg aus. Auch dies dürfte eher gewöhnlich sein für die Legion der Autoren, die nicht das Glück haben, im Scheinwerferlicht der Medien zu gedeihen: So kam der Dämpfer wenig später. Der Verlag stellte die ganze Sparte ein, ehe das nächste Buch unter Vertrag kam.
Doch im Pech blieb mir das Glück gewogen. Mit Esslinger fand sich ein anderer Verlag, der an historischen Jugendbüchern interessiert war. Mit den dort veröffentlichten Jugendromanen übers Bamberger Spätmittelalter und die Wikinger wurden Lesereisen realistisch – die Tantiemen waren nicht nennenswert, denn Jugendliche sind wohl die schwierigste Zielgruppe überhaupt: Die Eltern schenken seltener Bücher, und die Jugendlichen selber kaufen noch keine, da sie genügend andere Dinge im Kopf haben. Lehrer sind dafür um so dankbarer, wenn sie eine Veranstaltung bekommen können, die sowohl inhaltlich anspruchsvoll, als auch spannend und anschaulich ist. Nur leider mangelt es bei den meisten an Kommunikation mit den Kollegen, was ein Weiterempfehlen beinahe ausschloss. Dennoch rollten die Buchungen auch Dank des guten Netzwerks des Boedecker-Kreises herein, und die Jahre verflogen mit mehrwöchigen Lesereisen im Frühjahr und Herbst im Nu – unangenehm schnell sogar, denn durch die Termine wurden sie in kürzere Abschnitte geteilt.
Vom Autor zum Schriftsteller: Wenn die Berufung zum Beruf wird
So ermöglichten mir vor allem Lesereisen die Finanzierung des Studiums. Mit der Veröffentlichung eines Jugendromans über Wikinger mit Vorvertrag – und mit einem durch Honorarverringerung aus Liebe zum Buch selbst durchgesetzten Lesebändchen – war die selbstgesteckte Grenze überschritten, ab der ich mich Schriftsteller nennen zu dürfen erlaubte. Denn Schriftstellerei ist kein beliebiger Begriff, den man sich folgenlos anheften kann. Vielmehr ist es eine Berufsbezeichnung, die eine entsprechend professionelle Herangehensweise an die Arbeit, und auch an Dinge wie Vertrags- und Honorarfragen erfordert. Und die Verantwortung mit sich führt. Sowenig, wie sich ein Hobbybastler Schreiner nennen würde, so wenig hatte ich es zuvor gewagt, mit den paar veröffentlichten Büchern diesen Namen zu tragen.
Das hatte sich nun geändert. Dazu gehörte nach meinem Selbstverständnis die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft, dem Verband deutscher Schriftsteller. Die ganz praktische, gar nicht akademische Bedeutung einer solchen solidaren Mitgliedschaft durfte ein guter Freund von mir am eigenen Leibe erfahren, als ihn der gewerkschaftliche Rechtsbeistand vor hohen Strafzahlungen an echauffierte »Zuschussverlage« rettete. Und dazu gehörte, sich unter Kolleginnen und Kollegen umzuhören und nach Interessengemeinschaften zur Stärkung der Position von Autorinnen und Autoren Ausschau zu halten.
Gemeinsam sind wir (vielleicht) stark: Ausschau nach Autorenvereinigungen
Allerdings waren die Treffen des VS Berlin sehr heterogen, da Autoren aller Gattungen und Professionalisierungsgrade dabei waren, und sie waren nur bedingt für meine Tätigkeitsfelder – Jugendbuch und historischer Roman – zutreffend. Durch Zufall lernte ich aber auf diesen Treffen in Titus Müller einen Kollegen kennen, der gerade mit dem Veröffentlichen begonnen hatte und genau so wie ich erpicht darauf war, etwas zu unternehmen. Das passte mir gut, denn auch die lose Autorengruppe Kinder- und Jugendliteratur, die ich mitbegleitet hatte, war nicht mehr so recht aktuell.
Also initiierten wir beide kurzerhand einen bundesweiten Autorenkreis für Autoren historischer Romane. Wir orientierten uns dabei am Vorbild des Syndikats der Krimischreiber. Der Autorenkreis Historischer Roman »Quo vadis « war geboren.
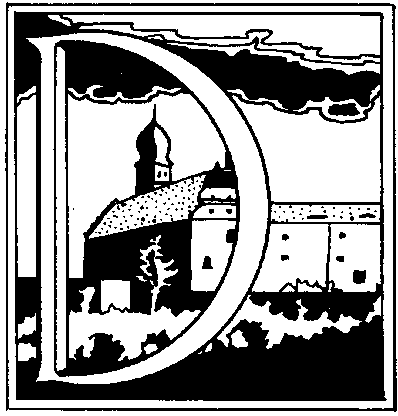
as, was mit einer Handvoll Autoren 2002 im Fontane-Haus in Berlin begann, sollte über die Jahre zu einem stattlichen Verein anwachsen. Die Jahrestreffen an historischen Orten mit Lesungen zunächst aller, dann ausgewählter Mitglieder am Samstagabend – auf der Kulmbacher Burg, in den Kasematten Magdeburgs, auf dem historischen Schloss in Hamburg-Bergedorf, in den historischen Sälen in Speyer und vielen weiteren – stießen auf reges lokales Interesse, und der ausgelobte Sir Walter Scott-Literaturpreis erwarb sich Ansehen. Seine erste Vergabe war durchaus spannend: So waren die Ausgezeichneten verwundert darüber, das Preisgeld von mehreren tausend Euro wie angekündigt in echten Goldmünzen zu erhalten. Nun hat Gold die Eigenschaft, keinen konstanten Wert zu besitzen, bis man es in Währung umtauscht. Es war eines der wohl eher seltenen Vorkommnisse in der Menschheitsgeschichte, dass ein Mensch sich später darüber beschwerte, echtes Gold überreicht zu bekommen zu haben.

Eine andere Form von Gold war der Goldschnitt, den die Sonderausgabe des ersten Gemeinschaftsromanes im Aufbau-Verlag bekam: Gemeinsam mit Titus Müller konnte ich das Entstehen eines Romans von zwölf Autoren koordinieren. Viele Besprechungen über den Weg der Handlung, Abstimmung zwischen den bereits geschriebenen und noch zu schreibenden Kapiteln, deren nacheinander jeder Autor zwei verfasste, die Spannung, zu lesen, was der oder die nächste aus dem bisher Geschriebenen machte, das war durchaus sehr spannend. Tatsächlich sollte sich der Roman in mehreren höheren Auflagen sehr gut verkaufen. Ihm folgten drei weitere nach gleichem Prinzip, aber jeweils mit angepassten Herangehensweisen: War es beim ersten der individuelle Schreibstil des Einzelnen, lag ein andermal der Fokus auf einem möglichst kohärenten Stil. Die breite Aufstellung bei der Expertise ergab einen prächtigen Expertenfundus zu dem jeweiligen historischen Thema, und dass einige bekanntere Autorinnen und Autoren mitwirkten, war der Außenwahrnehmung gewiss nicht abträglich. Die Herausgeberarbeit erinnerte dabei gelegentlich an das Lenken eines Wagens mit zwölf Pferden, die allerdings glücklicherweise überwiegend gut trainiert waren.
Neben der Herausgebertätigkeit wollten eine Promotion bewältigt, eine kriminologische Einrichtung mit einem Kollegen aus der Taufe gehoben und eigene Romane veröffentlicht werden. Dank des Kriminologen wurde ein historischer Roman auf den realen Fall eines angeblichen Werwolfs von Bedburg gelenkt, und das bot dankbares und blutrünstiges Material. Und auch die Wikinger kamen erneut zu Ehren. Mit erfolgreich abgelegter Falknerprüfung vor der Oberen Jagdbehörde war der wikingische Handel mit seinen blaufüßigen, weißgrauen Gerfalken ein dankbares Thema. Allerdings erwies sich hier eine Schwäche des Erwachsenenromans. Wo es im Bereich Jugendbuch an Leseaufträgen nicht gemangelt hatte, kamen beim Erwachsenenroman keine herein. Unrecht war mir dies indes nicht, da Lesereisen viel Zeit verschlangen. Aber es fiel auch eine wichtige Säule als Einkommen weg. Fachbücher und die ersten Sportsachbücher zu meiner neuen Leidenschaft, dem Jugger, konnten dies nur bedingt kompensieren – Bücher und insbesondere Fachliteratur sind ein reichlich ungeeignetes Medium zur Sicherung des Lebensunterhalts. Da sprangen andere Tätigkeiten, wie koordinatorische Tätigkeiten beim Aufbau eines privaten Instituts, ein.
Viele Publikationen, schweres Terrain: Die Verlage
Die Lage an der Verlagsfront wurde derweil nicht einfacher. Der »Hype« des historischen Romans begann abzuflauen. Vielleicht als Gegenreaktion begannen die Verlage, auch dort das Etikett »historischer Roman« aufzukleben, wo reichlich unhistorische schmalzige Liebesprosa enthalten war – folgerichtig begann das neue Etikett »Love and Landscape« schließlich den historischen Roman abzulösen. Selbst im Autorenkreis flammte ein Konflikt zwischen den rein unterhaltend und oft reichlich unhistorisch schreibenden Kollegen mit den anderen Autoren auf, fühlten erstere sich doch nicht ausreichend als »Literaten« behandelt – und unterschlugen dabei gelegentlich großzügig, dass sie für ihre teilweise tatsächlich wenig literarischen Produkte große Verkaufszahlen einfuhren und Geld verdienten, was den an Qualität interessierten Literaten eben durch ihren Anspruch verwehrt blieb.
Zur Krise des historischen Romans kam die Einbahnstraße der Übersetzungen, die US-amerikanischen Autoren einen gewaltigen Vorteil einzuräumen schienen. Lieber übersetzte ein Verlag ein gutgehendes Buch aus den USA, als einen deutschen Autor zu fördern, und selbstredend war es für deutsche Autoren kaum möglich, umgekehrt auf dem englischsprachigen Markt Fuß zu fassen.
Das obligatorische »O Tempora, O Mores!«
Inzwischen hatte das Internet Einzug gehalten, die schlechte Transparenz auf Verlagsseite änderte sich damit allerdings zumeist wenig. Während es in Schweden beispielsweise für gewöhnlich kein Problem ist, jeden Mitarbeiter direkt per Mail zu kontaktieren, verstecken sich deutsche Verlagsmitarbeiter hinter den hohen Mauern der Anonymität. Von Augenhöhe zwischen Verlag und Autor bzw. Autorin kann keine Rede sein, solange kein Vertrag auf dem Tisch liegt. Nur der bereits angenommene Autor erhält das Privileg, mit den Damen und Herren eines Verlages direkt zu kommunizieren – der gewöhnliche Schriftsteller ist und bleibt, von wenigen wohltuenden Ausnahmen abgesehen, Bittsteller, der seine Manuskripte postalisch an eine anonyme Adresse, genannt »Lektorat«, zu senden hat. Und der in den allermeisten Fällen mit dem bereits erwähnten Standardschreiben abgespeist wird. Bereits unter Beweis gestelltes Können und Referenzen scheinen dabei kaum eine Rolle zu spielen. Man kann nun mit angeblichen Zwängen und Personal argumentieren, es bleibt merkwürdig, wenn Verlage im Jahr 2017 immer noch nur postalische Zusendungen akzeptieren.
Kein einfaches Feld also selbst für handwerklich erfahrene, sprich: hochqualifizierte Schriftsteller. Man halte sich vor Augen, dass selbst im Falle einer Zusage weder ein warmer Geldregen, noch eine Anstellung oder sonst etwas winken, »nur« eine Buchveröffentlichung, die aller Wahrscheinlichkeit nach Tantiemen im maximal vierstelligen Bereich generieren und nach einem Jahr vergessen sein wird – auf die Buchmessen zu fahren, um Verlage zu akquirieren, ist wirtschaftlich gesehen daher Unfug und ein Luxus, den sich entweder Arbeitssüchtige oder Gelangweilte sich leisten können.
Es gibt eine Scheinlösung für diese Crux: Die literarischen Agenturen.
Die neuen Herren: Agenturen als Vorlektorate
Nun gibt es Stimmen, die faktoidisch behaupten, es seien nun einmal Agenturen und nicht mehr einzelne Autoren, die die Zusammenarbeit mit den Verlagen zu regeln hätten und man müsse mit der Zeit gehen. Dass sich ausgerechnet der Schriftsteller, einer der wenigen freidenkerisch angelegten Berufe, nun der Willkür jener unterwerfen sollen, die häufig von marktgerechter Ideologie geprägt sind, klingt wie ein Hohn. Sehr bezeichnend auch die Webseiten deutscher Agenturen, die Autoren auffordern, sich bei ihnen zu »bewerben« – als wäre die Autoren ihre potentiellen Angestellten und nicht umgekehrt die Agenturen selber Dienstleister für die Autoren. Den Verlagen kann’s nur recht sein – sie ersparen sich aufwändige Lektorate und Manuskriptauswahl, den lästigen ersten Kontakt mit all jenen, die sie sonst mit ihren Texten belästigt hätten.
Und ein letztes: Das »saturierte Milieu« ist nicht typisch
Diese Erfahrungen mit dem Literaturbetrieb decken sich wenig mit einer derzeit geäußerten Meinung, der »brave« und »konformistische« Charakter der Gegenwartslitertaur in Deutschland sei auf ein »gleiches saturierte Milieu« zurückzuführen. Sicher, wenn die Politik »nicht mehr« Schriftsteller konsultiert, so darf umgekehrt in Frage gestellt werden, welche nennenswerten Qualifikationen zur Sache eine Person einzubringen hat, die sich durch die Fähigkeit zum Erzählen von Geschichten auszeichnen mag – schreiben allein macht nicht weise. Und es mögen wohl die Absolventen einer anachronistischen Schreib-Universität (als wäre Schriftstellerei nicht Utopie und Lebenserfahrung, sondern schabloniert neoliberales Melkgut) eher konform, hip und angepasst sein, als Menschen, die allein dank ihrer Begeisterung für das Schreiben, ja, ihrer Schreibsucht, dank ihrer Lebenserfahrung, dank ihrer visionären Utopien, dank ihres Sendungsbewusstseins Buchdeckel mit Bedeutung füllen.
Aber es sind nicht die saturierten Hipster von der Uni, die den deutschen Literaturbetrieb angeblich einförmig und angepasst machen. Diese Leistung darf getrost den Verlagen zugestanden werden. Denn sie sind es, die das Agenturwesen mit offenen Armen empfangen haben, das ihnen ein billiges Vorlektorat ist und doch zugleich einer marktgerechten Konformität Vorschub leistet. Sie sind es, die sich durch opportunistische Fusionspolitik plötzlich dem Zwang gegenübersehen, ihren neuen Mutterverlagen schwarze Zahlen zu präsentieren. Sie sind es, die durch mangelnde Solidarität untereinander es zugelassen haben, das der führende Online-Buchhändler ihnen frei assoziierte Preismargen vorschreiben kann, indem sie es beispielsweise hinnahmen, dass einer der Ihren wegen Nichtakzeptanz der Marge aus dem Programm genommen wurde. Hätten stattdessen die Großen mit ihren Bestsellern den Onlinehändler kurzerhand boykottiert – die Welt sähe wohl anders aus.
Summa summarum
 So bleibt das Schreiben auch nach zwanzig Jahren und ebensovielen Veröffentlichungen summa summarum eine stete Herausforderung, sich zu verbessern, und es bleibt eine Gratwanderung. Die wird weitergehen, solange die Begeisterung, oder nennen wir es Sucht, andauert. Die Welt ist einfach zu spannend, um sie nicht in Worten aufblühen zu lassen.
So bleibt das Schreiben auch nach zwanzig Jahren und ebensovielen Veröffentlichungen summa summarum eine stete Herausforderung, sich zu verbessern, und es bleibt eine Gratwanderung. Die wird weitergehen, solange die Begeisterung, oder nennen wir es Sucht, andauert. Die Welt ist einfach zu spannend, um sie nicht in Worten aufblühen zu lassen.
Ruben Philipp Wickenhäuser hat zuletzt die Novelle »Järngård. Der Fluch des Erzes« im Verlag Das beben vorgelegt. Er lebt mit seiner Familie in Mittelschweden.
Mehr zum Autor im Internet unter uhusnest.de


