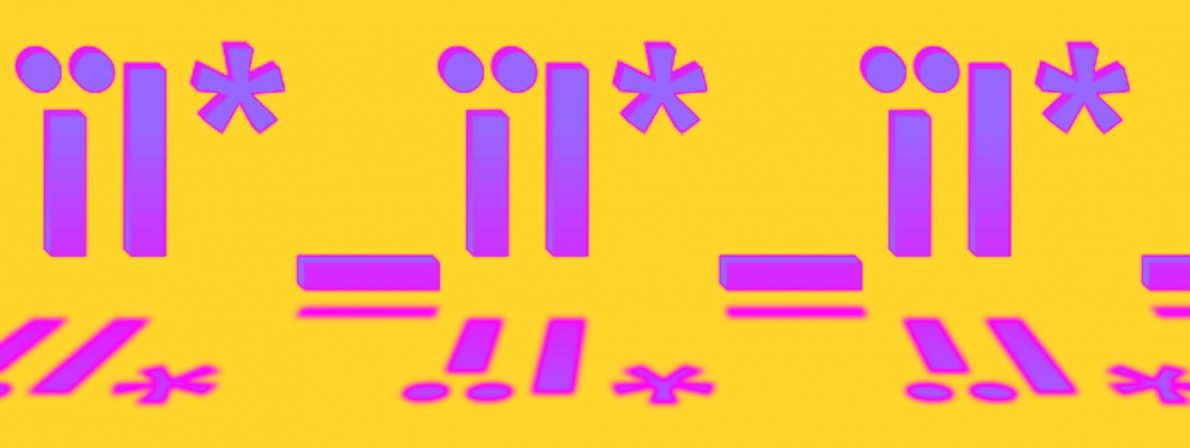
Wie können wir gerechter sprechen? Das »Gendern« ist nicht neu und wird heftig diskutiert. »Das Gender-Sternchen« ist alles andere als unproblematisch«, meint Ruben Wickenhäuser. In diesem Beitrag erläutert Wickenhäuser die Probleme, und er zeigt Alternativen auf.
»Wir wollen mit der Anwendung der geschlechterumfassenden Sprache [mittels des Gendersternchens] in der Stadtverwaltung Hannover sehr deutlich machen, dass wir jeden Menschen in der jeweiligen Geschlechtsidentität respektieren«, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay kürzlich anlässlich des Gutachtens einer Professorin für Geschlechterstudien, das geschlechtergerechte Sprache zur demokratischen Staatspflicht erhebt.
Höchste Zeit, ließe sich sagen, denn das »Gendern« ist nicht neu. Schon Anfang der 90er Jahre erfreute sich das »Binnen-I« wachsender Beliebtheit. Es klang schlüssig, die weibliche Form mit Hilfe eines großen »i« an Substantive anzuflanschen. Durchgesetzt hat es sich nicht, und zwar sicher weniger aus Ablehnung einer inklusiven Schreibweise heraus, sondern, wie die Vielzahl alternativer Suffixe vermuten lässt, aufgrund des Gefühls der Unzulänglichkeit dieser Form.

Das Beispiel Hannover zeigt, wie dreißig Jahre später eine dieser Alternativen den Siegeszug angetreten hat. Das »Binnen-I« sah sich dem Vorwurf eines »binären Geschlechterbildes« ausgesetzt, da es zwar die biologischen, nicht jedoch die sozialen Geschlechter versinnbildliche, deren Einbeziehung heutzutage zum Gradmesser für Toleranz schlechthin avanciert ist. Und ganz abgesehen davon ließe sich mit Freud argumentieren, dass es nur ein Phallussymbol mehr sei. An seine Stelle ist das Sternchen getreten, präsenter und wirkmächtiger, als es das Binnen-I je gewesen ist. Artikel, Hinweisschilder, manches Verwaltungsschriftstück, ja selbst akademische Texte werden nun mit Sternchen versehen. Was einst ein Anmerkungszeichen gewesen ist, hat eine steile Karriere hin zum Symbol der Gleichheit gemacht. Denn das Sternchen vermag eben nicht nur für zwei Geschlechter zu stehen, sondern für alle, so begründen es seine überaus erfolgreichen Fürsprecher. Es entbehrt auch einer freud’schen Konnotation, auch wenn eine solche, immerhin weniger geschlechtsspezifisch, durch Schließmuskelassoziationen durchaus möglich wäre. Selbst dies würde aber nicht gegen seine Verwendung sprechen, schließlich verfügt jeder gesunde Mensch über einen solchen.
Nun verspricht die zeitgenössische Popularität des »Gender-Sternchens« allein aber keineswegs eine sichere Zukunft: Es ist alles andere als unproblematisch.
Das Problem der Lesbarkeit
Lesbarkeit ist die vor allen anderen Dingen zu erfüllende Anforderung an Schrift an sich, und ausgerechnet hier zeigt das Sternchen massive Unzulänglichkeit. Das beginnt schon damit, dass das Sternchen nicht zu unserem Alphabet gehört. Es handelt sich weder um einen Buchstaben, noch um Interpunktion, und selbst wenn das Zeichen als neue Interpunktion akzeptiert werden würde, so war bislang Interpunktion innerhalb von Worten eine Ausnahme: Als umgangssprachliche Verkürzung (»Ich mag’s«) oder als Trenner (»auf- und abschwellend«). Und das aus gutem Grund, bleibt die konsequente Verwendung von Interpunktion innerhalb von Worten doch stets ein Stolperstein beim Lesen.
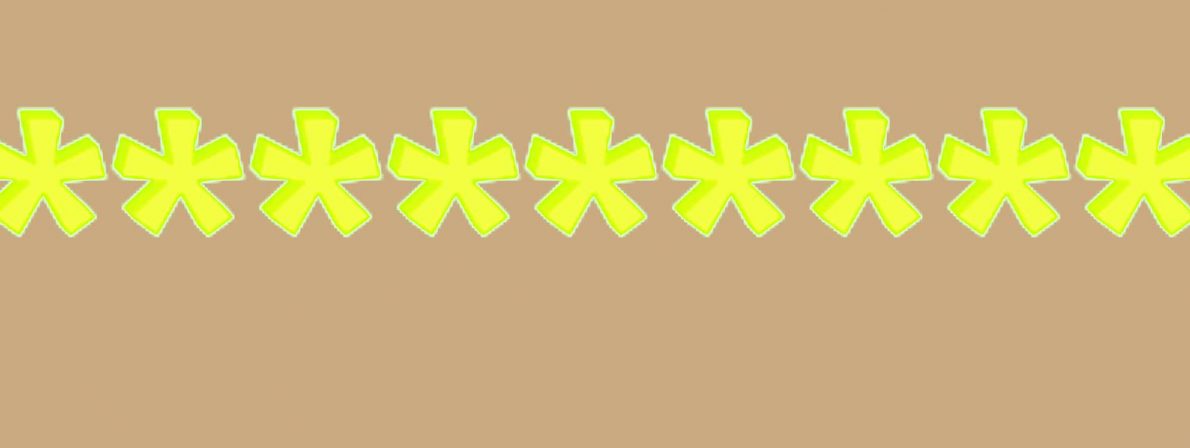
Zudem bleibt es nicht beim einfachen Sternchen. Da die deutsche Sprache in ihrer aktuellen Form zum Gendern schlecht taugt, muss konsequenterweise auch der Artikel gedoppelt werden: »ein*e Teilnehmer*in«. Das funktioniert bei gelegentlicher Verwendung, oder um eine bestimmte politische Aussage zu betonen. Nicht aber in Texten, in denen es um das Verständnis komplexer Sachverhalte geht, denn hier wirft die gar nicht so selten formulierte Ideologie einer moralischen Pflicht — »Du sollst gendern, sonst verhältst du dich diskriminierend« — dem Grund, weshalb der betreffende Text erstellt wurde, Knüppel zwischen die Beine. Schließlich wird eine Abhandlung über das Verhalten von subatomaren Teilchen nicht veröffentlicht, um die gesellschaftliche Debatte über »Diversität« zu unterstützen, sondern um die komplizierten teilchenphysikalischen Zusammenhänge verständlich zu machen: ein Thema, das auch ohne Sternchen und »der*die«, »ein*eine« schwer genug zu begreifen ist. Um die Sache anhand eines weniger akademischen Themas zu illustrieren, sei hier der Auszug aus einem Sportregelwerk zitiert:
»Läufer*innenkampf. Im Läufer*innenkampf besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr für beide Spieler*innen, da sie sich in unmittelbarem Körperkontakt befinden. Sobald eine*r der beiden Läufer*innen gegen die Regeln verstößt, muss der*die Schiedsrichter*in sofort in den Läufer*innenkampf eingreifen … Beobachtet ein*e Schiedsrichter*in, dass ein*e Spieler*in falsch zählt, sollte er*sie ihn*sie sofort darauf aufmerksam machen.«
Hier tritt die Aussage hinter einer politischen Botschaft zurück, die nichts mit dem ursprünglichen Thema des Textes zu tun hat. Und gewiss nicht wenige, die es gezwungenermaßen verwenden, schütteln den Kopf darüber.
Ein realer Buchstabe anstelle eines Zeichens: Das Trema-ï
Wenn es wirklich um eine inklusive Sprache geht, dann erscheint es angesichts des gezeigten Beispiels rätselhaft, weshalb sich ein Sternchen, gelegentlich auch der Unterstrich oder ein Doppelpunkt durchgesetzt haben. Denn einen realen Buchstaben gäbe es. Das Trema, also die Pünktchen auf Umlauten, findet sich in einigen Sprachen auch auf dem »i«. Wer Karl May gelesen hat, kennt dies beispielsweise vom »Scheïtan«. Auf der Windows-Tastatur findet es sich nicht, kann aber über die Tastenkombination Alt+0239 für »ï« und Alt+0207 für »Ï« geschrieben werden. Auch ließe sich beispielsweise »:i« in den meisten Schreibprogrammen automatisch durch »ï« ersetzen.
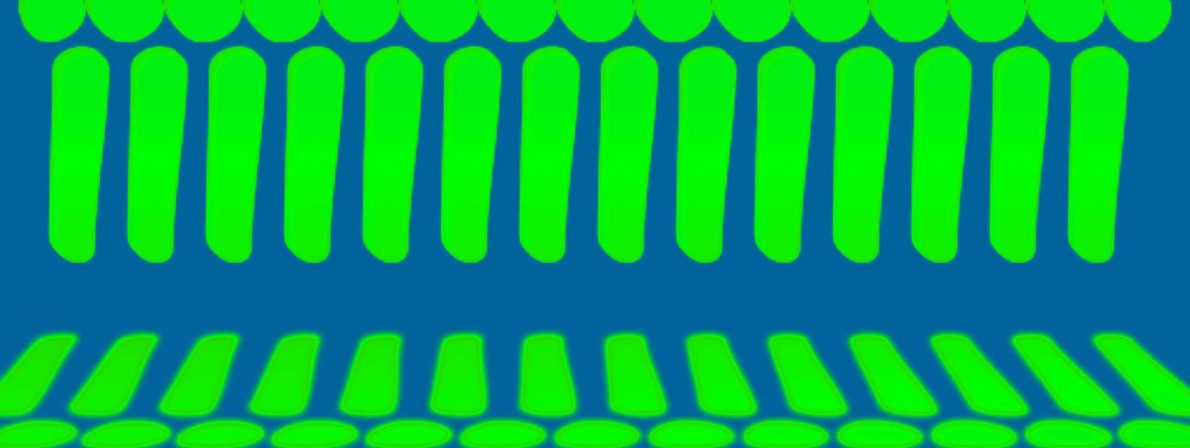
Damit würden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen signalisiert das Trema den Befürwortern der gegenderten Lautsprache einen Hiatus, also einen Trenner bzw. einen »Glottisschlag«. Zum anderen passt es auch symbolisch, um wiederum mit Freud zu sprechen, kann hier doch jede beliebige Kombination an Geschlechtsmerkmalen oder auch sich zwei Umarmende hineinimaginiert werden. Anstelle von »Spieler*in« stünden dann »Spielerïn«. Besser noch: Die Kurzform »Spielerï« böte sich im Plural an, das Problem der Artikel zu umgehen:
Anstelle »Der Spieler läuft« oder »Der*die Spieler*in läuft« hieße es dann »Spielerï laufen«.
Das mag erst einmal merkwürdig klingen. Besser als die Verrenkungen mit Sternchen, Unterstrichen und Doppelpunkten sowie bemühten Glottisschlägen ist dies allemal, schlicht weil es sprachlich naherliegender ist. Allerdings wäre die Plurallösung wohl ein sprachlich zu großer Sprung und vielen zu infantil in seinem Habitus. Aber im Vergleich Sternchen ist es immer noch um Längen besser.
Ein weiterer Vorteil wird für manchen jedoch ein Nachteil sein: Eben weil es weit weniger sperrig ist, lässt sich damit der Welt weniger gut das heldische Einstehen für eine moralische Ansicht verkünden.
Zum Vergleich der zitierte Text:
»Läuferïkampf. Im Läuferïkampf besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr für beide Spielerï, da sie sich in unmittelbarem Körperkontakt befinden. Sobald Läuferï gegen die Regeln verstoßen, müssen Schiedsrichterï sofort in den Läuferïkampf eingreifen … Beobachten Schiedsrichterï, dass Spielerï falsch zählen, sollten sie diese sofort darauf aufmerksam machen.«
Klingt infantil? Gewiss. Aber deutlich lesbarer als die Sternchenversion ist es, und hätte daher bessere Chancen, durch Gewöhnung als nicht mehr infantil akzeptiert zu werden.
Man kann natürlich diese Form der Identitätspolitik als infantile Überempfindlichkeit ansehen, wie es der Philosoph Robert Pfaller getan hat, oder auch Zweifel daran äußern, dass hier mit den USA ausgerechnet eine ebenso bigotte wie seit jeher hypersensibel-hysterische Nation als großes moralisches Vorbild proklamiert wird. Wer der Ansicht ist, dass die Nennung der zwei biologischen Geschlechter allein soziale Geschlechter nicht ausgrenze, kann weiterhin beide nennen – oder, wie gelegentlich im Englischen, das Geschlecht nach Abschnitt wechseln.
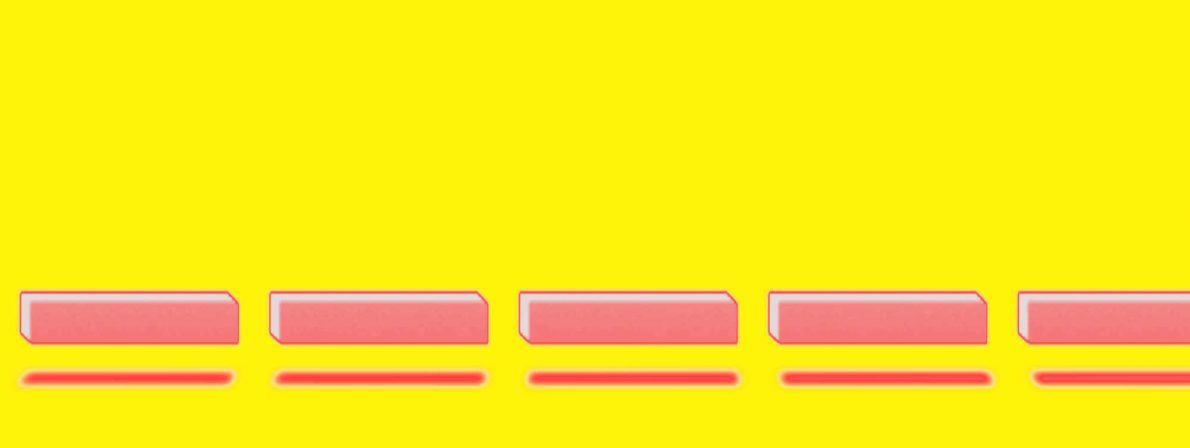
Kein Untergang des Abendlandes, so oder so
Häufig ist von Verfechterinnen und Verfechtern des Sternchens zu hören, Kritiker würden die Diskussion überspitzt und hysterisch führen. Und so wurde eine Online-Diskussion der Befürworter mit der ironisch gemeinten Überschrift versehen: »Gendersternchen: Untergang des Abendlandes?«
Nein, die Verwendung des Sternchens bedeutet sicher nicht den Untergang des Abendlandes. Der Verzicht darauf aber eben auch nicht.
Was allerdings tatsächlich Not tut, ist Solidarität anstelle von Spaltung — sonst droht tatsächlich der Untergang nicht nur des Abendlandes.
Ruben Wickenhäuser
Ruben Wickenhäuser, studierter Geschichtswissenschaftler, publiziert Romane, Fach- und Sachbücher und ist Mitglied im Autorenteam der Serie Perry Rhodan NEO. Er wurde mehrfach für sein ehrenamtliches Engagement in Deutschland und Schweden ausgezeichnet. Die Frage, wie geschlechtergerechte Sprache praktikabel umgesetzt werden kann und wo es dabei mehr um die Sache oder um Macht geht, beschäftigt ihn seit Jahrzehnten. Zum »Binnen-I« veröffentlichte er vor zehn Jahren auf Telepolis bereits einen Beitrag. Auch im literaturcafe.de veröffentlichte er immer wieder Beiträge zum Thema Schreiben.
Mehr über seine Arbeit unter uhusnest.de


Es gibt nur eine wirklich diskriminierungsfreie, klare Form: Das Generikum. Das Gendern im Deutschen beruht auf einer Lüge: Man leugnet den grundsätzlichen Unterschied zwischen Genus und Sexus. Gleichzeitig benutzt man eine sprachliche Ausnahme (“Zuschauerinnen”) als Standard und behauptet, das Generikum sei männlich.
Sprache dient der Klarheit und dem Verständnis. Durch Gender-Konstruktionen wird die Klarheit zerstört. Sagt man beispielsweise “Die Politiker Merkel und Macron trafen sich”, ist für jeden klar, hier haben sich zwei Politiker getroffen, deren Geschlecht völlig unerheblich für dieses Treffen ist. Sagt man “Die Politikerinnen und Politiker Merkel und Macron” ist das sachlich falsch. Den es ist nur eine Frau und nicht mehrere. Sagt mal “Die Politikerin Merkel und der Politiker Macron” wäre man zwar grundsätzlich auf einer halbwegs korrekten Seite, aber der Satz wird länger, sperriger und damit unverständlicher. Die Klarheit schwindet. 16 Silben drücken das selbe aus wie wesentlich verständlichere 10 Silben. Insbesondere da es für männliche Politiker keine spezielle Form gibt, auch wenn manche Lobbyisten wie neuerdings der Duden das behaupten.
Die einzig sinnvolle Form wäre wie im Englischen die Abschaffung der Sonderform mit “innen” am Ende und das Benutzen des Generikums, welches für alle Geschlechter steht, sogar für die Eingebildeten. Neue Kunstzeichen wie im Artikel vorgeschlagen sorgen nicht für Klarheit, sondern für Unklarheit, denn sie betonen die Sonderform, die rein weibliche Form. Von mir aus kann man die Sonderform mit “innen” am Ende durchaus lassen, wenn man unbedingt erwähnen will, dass die betreffende Person weiblich ist. Doch wo ist das – außer vielleicht bei Sexarbeitern – wirklich wichtig? Es geht doch um den Beruf, die Kompetenz der Person und es sollte dabei völlig egal sein, welches Geschlecht diese Person hat. Man sollte Geschlechterapartheid überwinden, nicht verschärfen, wie das alle Kunst- und Sonderformen statt des klaren Generikums tun.
Auf den Unsinn mit dem Partizip I (“Studierende”) gehe ich jetzt gar nicht ein, für was das Partizip I steht kann jeder in einem Deutschbuch nachlesen. Auch die Diskriminierung durch diese Kunstsprache für Nicht-Deutsche, Menschen mit Schreib-Leseschwäche, Menschen die auf Vorleseprogramme angewiesen sind usw., brauche ich nicht explizit auszuführen, das wurde oft genug getan.
Ich mache mir auch seit einiger Zeit Gedanken über das Thema und bin zu einer ähnlichen – aber nicht der gleichen – Schlussfolgerung gelangt wie der Autor. Erstmal: Das Problem, dass sich viele Fraue beim generischen Maskulinum nicht mit-gemeint fühlen, ist ein reales. Wäre stattdessen ein generisches Femininum üblich, fände ich als Mann das anfangs zwarwitzig, auf die Dauer aber nervig und ausgrenzend. Es ist also berechtigt, das Thema aufzugreifen.
Die heute propagierten Lösungen für eine gesprochene “gender gap” (wie _ : *) erscheinen mir aber alle nicht überzeugend, nicht nur weil sie zu einem schwer lesbaren Schriftbild führen. Tatsächlich würde ich die ganze Gap (also den Glottischlag) lieber vermeiden, weil das für mich künstlich und nicht flüssig klingt. Das spricht für mich dann auch gegen den Vorschlag mit dem Trema-i. Was also dann?
Ich würde eine Lösung propagieren, die es heute schon in der deutschen Sprache gibt und die ausbaufähig ist. Wenn ein Student und eine Studentin ihre berufliche Situation benennen sollen, sagen sie nicht “Wir sind Student*innen”, sondern “Wir sind Studis”. Auszuildende beiderlei Geschlechts werden gemeinsam als “Azubis” bezeichnet. Neulich habe ich gelesen, dass sich die Mitglieder von “Extinction Rebellion” zusammen nicht “Rebell:innen” oder dergleichen nennen, sondern sie nennen sich “Rebellis”. Die junge Generation hat da also längst eine Lösung für das Problem gefunden.
Für die Pluralbildung von Lehnwörtern nutzt das Deutsche standardmäßig ein “s”, für Personen bietet sich offenbar das “is” an. Bildet man als geschlechtsneutralen Plural nach diesem Muster Professoris, Polizistis, Sportleris und Spieleris, so lässt sich das im Satz übersichtlich schreiben und auch weiterhin gut sprechen, denn eine “gender gap” gibt es nicht. Es hat sogar den Vorteil, dass man sprechend mit dem “i” ansetzt wie zum weiblichen Plural “innen” und dann nur die Abkürzung zum “is” nimmt.
Daran kann man sich gewöhnen. Es klingt ein wenig schweizerisch und ein wenig heiter, aber das kann der gestrengen deutschen Sprache gar nicht schaden. Die Lösung hat auch noch den Vorteil, dass man bei Bedarf einen geschlechtsneutralen Singular mit “i” bilden kann: Viele Azubis haben am Wettbewerb teilgenommen, aber nur ein/e Azubi wird gewinnen.
Meiner Meinung nach kommt der neutrale is-Plural dem Sprachgefühl mehr entgegen als die heutigen Varianten – und braucht im Gegensatz zu Herrn Wickenhäusers Vorschag auch kein im Deutschen unübliches Spezialzeichen.
Interessanter Gedanke, einige Anmerkungen:
1. Der Mensch hat nicht nur einen, sondern gleich mehrere Schließmuskel im Körper.
2. Der Trema-Plural verliert leider an Exaktheit und ist deswegen nicht praktisch in den meisten Texten.
3. Statt eines auf der Tastatur vorhandenen Zeichens, welches nicht zum Alphabet gehört, über Umwege ein zum Alphabet gehörendes Zeichen zu nutzen, nur weil es zum Alphabet gehört, erscheint mir dann doch recht (mit Verlaub) korinthenkackend. ^^
4. Wieso sollte Gendern ausgerechnet einen Fachartikel über subatomare Teilchen verhindern? Ausgerechnet in diesem Bereich geht es doch wahrscheinlich seltener um Personen und mehr um Gegenstände. (Ich weiß nicht, ob subatomare Partikel gegendert werden möchten und wäre ggf. gewillt, auch das umzusetzen.)
Als Legasthenikerin habe ich mit verschiedenen Formen des Genderns durchaus Probleme, der Stern und als Alternative der Unterstrich haben sich für mich persönlich als gut lesbar erwiesen. Andere Legastheniker*innen, die ich kenne, sehen das anders, die perfekte Lösung gibt es also leider nicht. Auch die Lesbarkeit beim Gebrauch von Screenreadern muss natürlich berücksichtigt werden. Aktuell finde ich es gut, dass verschiedene Versionen der gegenderten Sprache parallel verwendet werden und bin gespannt, welche Lösung sich durchsetzt.
Wie wohltuend endlich einer sachlichen Diskussion des Themas beizuwohnen.
Genus und Sexus sind in der Tat verschiedene Dinge und nicht jede Inkongruenz zwischen ihnen wird vehement diskutiert. Am Mädchen hat bisher noch niemand Anstoß genommen, obwohl sein sächlicher Genus dem weiblichen Sexus nicht folgt. Der Mensch oder der Erwachsene – mit männlichem Genus obgleich sie vom Sexus her zwei Geschlechter abbilden können – haben meines Wissens auch noch nicht zu Beanstandungen geführt. Vielleicht weil hier die meisten davon ausgehen, dass semantisch beide Geschlechter gemeint sind. Bei anderen Substantiven ist das nicht so, vielleicht weil früher damit tatsächlich nur Männer gemeint waren, weil nur Männer Bürgermeister oder Polizisten waren, was heute – Gottlob! – anders ist. Wir könnten einfach umlernen und sagen: Bürgermeister steht heute – wie Mensch – für beide Geschlechter. Das scheint aber wenig Zuspruch zu finden, vielleicht weil Worte wie Bürgermeister einer Kultur zugeordnet werden, die man nicht mehr dulden will – wie nun auch das Wort.
Wollen wir nicht von Mädchen und Jungen sprechen, können wir Kinder sagen (Genus sächlich, Sexus weiblich oder männlich). Hier verhält sich das Genus neutral und durch die Eigenständigkeit des Wortes gibt es keine Irritationen. Probleme machen Substantive, deren weibliche Version aus einer männlichen Grundform durch das Anhängsel “in” gebildet werden. Beim Artikel ist das ähnlich z.B. ein/eine. Wie schön wäre es, wenn wir alle Geschlechter meinten, in diesen Fällen ein Wort wählen zu können, das dies eigenständig leistet, so wie bei Kinder, denn die Kombilösungen à la Sternchen sind sperrig und selbst über das flottere Trema-ï stolpert man doch leicht. Für jedes dieser Substantive müsste ein solches Wort gewählt werden, möglichst angepasst an die Eigenheiten der deutschen Sprache, z.B. könnten alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einfach Stadtoberhäupter (Genus sächlich) sein.
Auf diese Weise ließen sich die Ziele, die Sprache nicht zu entstellen, die Lesbarkeit und Verständlichkeit zu sichern und dem Bedürfnis nach gefühlter kultureller Aktualität zu entsprechen vielleicht besser erreichen.
Ich greife hier einen Vorschlag von Florian Adler, Honorarprofessor für Kommunikationsdesign an der HTW Berlin auf und plädiere für den MEDIO·PUNKT:
Leser·innen, Journalist·innen, Schauspieler·innen usw.
Im Gegensatz zum Trema-i, zum Sternchen, zum Doppelpunkt finde ich ihn weder aufgesetzt, noch mit schweizerischem Anklang, noch den Lesefluss sehr störend.
Mit folgender Tastatur generiert man ihn:
– Windows: Alt+0183
– MacOS: Shift+Alt+9
Und da, wo ein Text – vor allen Dingen in Büchern – durch das Gendern eine schwerfällige Note bekommen würde, empfehle ich einerseits Mut zur Ästhetik und andererseits gelassen und souverän zu bleiben.
Der Mediopunkt ist in der Tat dezenter als die anderen genannten Zeichen, jedoch behebt er einen der ungünstigen Effekte dieser Kombiausdrücke leider auch nicht: Wenn ich Leser·innen lese, sagt meine innere Stimme Leserinnen. Die ebenfalls gemeinten Leser sind mir dann nicht präsent. Andere Leser·innen berichten mir dies auch zu erleben. Ich fürchte wirklich, wir kommen nicht drum herum, jenseits der schlichten Klemmlösungen zu suchen und sprachlich etwas tiefer zu schürfen.
Jahrelang habe ich versucht, die verschiedenen Genderschreibweisen zu benutzen und es schließlich aufgegeben. Bisher hat mich keine Form der – wie ich sie nenne – geschlechterbetonenden Sprache überzeugen können.
Ob das jemand für diskriminierend hält, interessiert mich nicht. Wenn jemand eine irrige oder falsche Meinung über mich hat, ist er mir egal – schließlich haben wir Meinungsfreiheit. Das klingt ziemlich egoistisch, dient aber auch meinem persönlichen Schutz, denn der Versuch, es allen recht zu machen ist selbstzerstörerisch.
Korrektur: Statt “ist er mir egal” soll es “ist es mir egal” heißen.