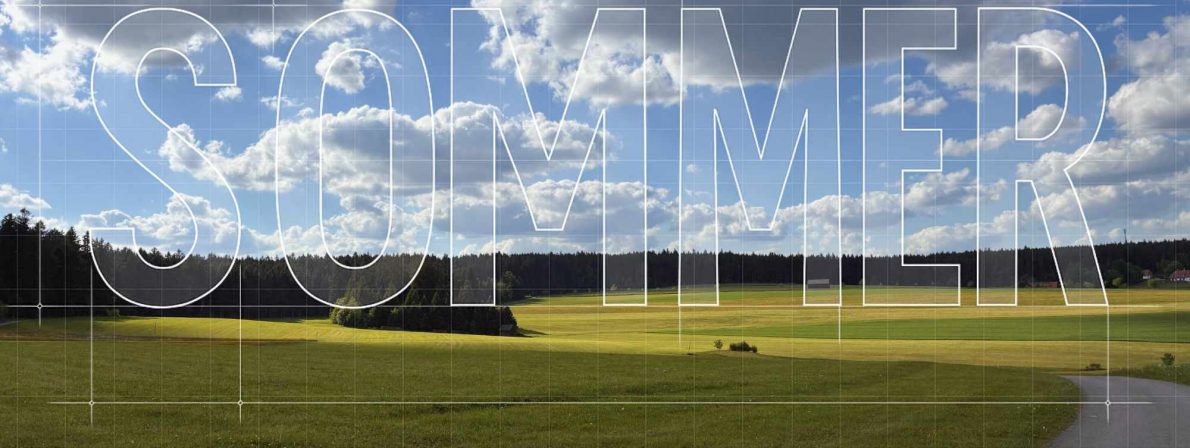
»Der Sommer war sehr groß« – ist das Vergangenheit oder Gegenwart? Eine scheinbar simple Frage entlarvt einen der raffiniertesten Tricks der deutschen Sprache und zeigt, warum Prosa und Lyrik völlig unterschiedlich ticken. Wir widmen uns dem Präteritum in Prosa und Lyrik. Danach wird die Zeit für Sie anders vergehen.
»Herbsttag« von Rainer Maria Rilke – hier klicken und das Gedicht lesen
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
»Der Sommer war sehr groß« – dieser Satz aus Rainer Maria Rilkes Gedicht »Herbsttag« führt uns direkt ins Zentrum einer sprachlichen Frage. Ist dieser Sommer bereits vorbei, ein nostalgischer Rückblick auf vergangene Tage? Oder erleben wir ihn gerade mit, während er sich vor unseren Augen entfaltet? Die Antwort führt uns in eines der faszinierendsten Gebiete der deutschen Grammatik: das erzählerische Präteritum.
Warum dieser Text entstanden ist? Hier klicken und mehr erfahren.
Im Sommer 2025 stellten wir im Schreibzeug-Podcast die Schreibaufgabe, einen Prosa-Text mit maximal 2.000 Zeichen zu schreiben, der mit dem Satz »Der Sommer war sehr groß« aus dem Rilke-Gedicht »Herbsttag« beginnen sollte. Daraufhin stellte eine Hörerin die Frage:
»Ich habe zu eurer Sommeraufgabe mal eine ganz blöde Frage: Wenn ich mit der Zeile beginne, der Sommer war sehr groß, bezieht sich der folgende Text dann auf einen bereits vergangenen Sommer oder liegt hier der Fall des erzählerischen Pretäritums vor? In der Lyrik verhält sich das doch anders als in der Prosa??«
Wir haben geantwortet, dass das unerheblich sei, denn obwohl die Zeile aus einem Gedicht stammt, wollen wir einen Prosatext.
Doch die Frage hat uns beschäftigt, denn sie war weder blöd noch unerheblich, und die nähere Beschäftigung damit führte zu diesem Text über das erzählerische Präteritum.
Was ist eigentlich das Präteritum?
Das Präteritum – auch »Imperfekt« oder »einfache Vergangenheit« genannt – ist zunächst einmal eine Zeitform: »ich ging«, »er sagte«, »sie dachte«. Im Deutschunterricht lernen wir, dass es die Vergangenheit ausdrückt, also etwas, was bereits geschehen ist. Soweit die Theorie. Die literarische Praxis jedoch zeigt: Das Präteritum kann viel mehr als nur »früher« bedeuten. Es kann auch Gegenwart sein.
Denn während wir im Alltag meist das Perfekt verwenden (»Ich bin zum Bahnhof gegangen«), ist das Präteritum die bevorzugte Erzählzeit der deutschen Literatur. »Ich ging zum Bahnhof« klingt nach Geschichte, nach Erzählung – und genau das ist der Schlüssel zum Verständnis.
Exkurs: Warum sprechen wir im Perfekt, schreiben aber im Präteritum?
Regionale Prägung: In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz dominiert das Perfekt schon seit Jahrhunderten. Auch im Norden setzt es sich zunehmend durch.
Lebendige Wirkung: »Ich bin gegangen« fühlt sich im Gespräch natürlicher an als »Ich ging« – das Perfekt wirkt direkter mit der Gegenwart verbunden.
Gegenwartsbezug: Das Perfekt signalisiert oft, dass Vergangenes noch relevant ist. »Ich habe das Buch gelesen« bedeutet: Ich weiß jetzt, worum es geht.
Ausnahmen: Verben wie »sein«, »haben« und Modalverben verwenden wir auch im Alltag oft im Präteritum (»war«, »hatte«, »konnte«), weil ihre Perfektformen umständlich klingen.
Literarischer Effekt: Gerade deshalb eignet sich das Präteritum so gut fürs Erzählen – es schafft automatisch die epische Distanz zwischen »echtem Leben« und »erzählter Geschichte«.
Das Präteritum, das keine Vergangenheit ist
Hier beginnt die Verwirrung – und das Interessante. In der Prosa funktioniert das Präteritum völlig anders, als es der Deutschunterricht vermuten lässt. Es wird zum »erzählerischen Präteritum«, einer besonderen Form, die nicht wirklich Vergangenheit ausdrückt, sondern eine spezifische Erzählhaltung schafft.
Das erzählerische Präteritum ist die Standard-Erzählform, die epische Grundausstattung der deutschen Literatur. Es etabliert eine kunstvolle Distanz zwischen dem Moment des Erzählens und der erzählten Welt, ohne dass diese Welt dadurch weniger gegenwärtig würde. »War« ist hier nicht wirklich vergangen – es ist ein Erzähltrick.
Nehmen wir einen klassischen Prosasatz: »Er ging zur Tür und öffnete sie.« Diese Handlung ist in der Erzählwelt eines Prosatextes unmittelbar präsent, lebendig, gegenwärtig – obwohl sie grammatisch im Präteritum steht. Oder denken wir an Kafkas berühmten Anfang: »Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.« Das »erwachte« und »fand« sind grammatisch vergangen, erzählerisch aber pure Gegenwart – wir sind unmittelbar Zeugen dieser bizarren Verwandlung.
Das Präteritum fungiert hier als Erzähltempus, nicht als Vergangenheitstempus. Es ist ein sprachlicher Kunstgriff, der es ermöglicht, von etwas zu erzählen, als würde es gerade geschehen, ohne den Anschein zu erwecken, der Erzähler sei mittendrin. Selbst das klassische »Es war einmal« aus Grimms Märchen meint keine wirkliche Vergangenheit, sondern lädt ein in die Gegenwart der Erzählung – in eine Welt, die entsteht, sobald wir zu lesen beginnen.
Die Lyrik macht ihre eigenen Regeln
In der Lyrik verhält sich das Präteritum jedoch grundlegend anders. Das Lyrische Ich steht meist näher am Moment des Sprechens, die Distanz zwischen Sprechakt und Gesprochenem ist deutlich geringer. Rilkes »Der Sommer war sehr groß« kann hier durchaus auf einen bereits vergangenen, erinnerten Sommer verweisen – auf etwas, das tatsächlich vorbei ist und nun aus der Erinnerung heraus beschworen wird.
Vergleichen wir das mit einem anderen Rilke-Gedicht: »Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen« – hier ist das Präsens gewählt, die unmittelbare Gegenwart des Sprechens. Oder nehmen wir Goethes »Wandrers Nachtlied«: »Über allen Gipfeln ist Ruh’« – wieder Präsens für die direkte Erfahrung. Wenn dagegen Eichendorff schreibt »Es war, als hätt‘ der Himmel die Erde still geküsst« und von nächtlichen Feldern erzählt, dann ist das etwas anderes als wenn in einem Roman stünde »Die Ähren wogten sacht« – im Roman wären die Ähren erzählerisch da, bei Eichendorff sind sie erinnert. Als der Dichter die Zeilen in Berlin schrieb, dachte er in der Tat an seine oberschlesische Heimat zurück.
»Mondnacht« von Joseph von Eichendorff – hier klicken und das Gedicht lesen
Es war, als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst’.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis’ die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
Diese Unterscheidung ist mehr als grammatische Spitzfindigkeit. Sie erklärt, warum uns Gedichte oft unmittelbarer ansprechen, während Romane uns in eine andere Welt entführen. Die Lyrik spricht häufiger aus der direkten Erfahrung heraus, die Prosa schafft bewusst eine epische Distanz.
Die Kommunikationssituation entscheidet alles
Der entscheidende Unterschied liegt in der jeweiligen Kommunikationssituation. Die Prosa-Form etabliert typischerweise eine epische Erzählsituation, in der zeitliche Distanz zur erzählerischen Grundkonvention gehört. Das Präteritum ist hier so selbstverständlich wie die Bühne im Theater – ein Rahmen, der die Fiktion ermöglicht, ohne sie zu stören.
Betrachten wir den Unterschied an einem konkreten Beispiel: »Die Sonne schien« könnte in einem Roman bedeuten, dass wir gerade dabei sind, einen sonnigen Tag zu erleben – die Sonne scheint in der Erzählwelt jetzt. In einem Gedicht hingegen wäre es eher die Erinnerung an einen sonnigen Tag, der vorbei ist. Heinrich Heines »Die Lorelei« demonstriert das perfekt: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin« – das Präsens der unmittelbaren Empfindung, gefolgt von »ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn« – auch hier Präsens für die gegenwärtige Erinnerung.
Die Lyrik suggeriert oft unmittelbare Gegenwart des Sprechens. Wenn ein Gedicht im Präteritum formuliert ist, wirkt dieses »echter«, vergangener als in der Prosa. Das Lyrische Ich scheint tatsächlich zurückzublicken, zu erinnern, zu reflektieren.
Der Trend zum Präsens in Romanen
Während das Präteritum jahrhundertelang die unbestrittene Erzählzeit der Literatur war, beobachten wir seit den 1990er Jahren einen bemerkenswerten Wandel: Immer mehr Romane werden im Präsens geschrieben, nähern sich damit der unmittelbaren Sprechweise der Lyrik an. Bestseller wie Suzanne Collins‘ »Die Tribute von Panem« oder Rebecca Yarros‘ »Fourth Wing – Flammengeküsst« erzählen durchgehend im Präsens – »Wir erreichen die Tür und er tritt dreimal donnernd dagegen« statt »Wir erreichten die Tür und er trat dreimal donnernd dagegen«.
Diese Entwicklung kehrt die traditionelle Rollenverteilung um: War früher das erzählerische Präteritum das Merkmal der Prosa und das »echte« Präteritum (mit Präsens-Wechseln) typisch für die Lyrik, so erobert nun das Präsens auch den Roman. Das scheinbar klare System gerät ins Wanken.
Dieser Wandel hat mehrere Ursachen. Das Präsens erzeugt unmittelbare Nähe, lässt die Leser direkter am Geschehen teilhaben. In einer Zeit, in der Filme und Serien mit ihrer visuellen Direktheit konkurrieren, suchen Autoren nach Mitteln, die ähnliche Intensität schaffen. Das Präsens simuliert die Gleichzeitigkeit des Erlebens – wir sind nicht Zuhörer einer Geschichte, sondern Zeugen eines Geschehens.
Besonders bei New-Adult-Literatur und psychologischen Romanen wird das Präsens bevorzugt. Es passt zur Selbstwahrnehmung einer Generation, die in sozialen Medien permanent im »Jetzt« kommuniziert. Auch die Übersetzungspraxis spielt eine Rolle: Viele erfolgreiche amerikanische Romane werden im Präsens geschrieben, deutsche Verlage übernehmen diesen Stil zunehmend auch bei ursprünglich deutschen Werken. Der Übersetzer Frank Heibert hat sogar 2021 bei seiner Neuübersetzung von Orwells »1984« aus dem Präteritum des Originals im Deutschen ein Präsens werden lassen.
Wann welche Zeitform wählen?
Für Schreibende stellt sich die praktische Frage: Präteritum oder Präsens? Die Entscheidung hängt von der gewünschten Wirkung ab. Das Präteritum schafft epische Ruhe, ermöglicht Reflexion und Übersicht. Es eignet sich für komplexe Handlungsstränge, historische Romane oder wenn der Erzähler mehr wissen soll als die Figuren.
Das Präsens hingegen erzeugt Dringlichkeit und Unmittelbarkeit. Es funktioniert besonders gut bei Thrillern, Coming-of-Age-Geschichten oder wenn die Perspektive eng an eine Figur gebunden ist. Allerdings kann es auf Dauer anstrengend wirken – die permanente Gegenwart lässt wenig Raum zum Atemholen.
Manche Autoren nutzen bewusst den Wechsel: Präteritum für Rückblicke, Präsens für die Haupthandlung. Das erfordert allerdings Fingerspitzengefühl, um nicht zu verwirren. Die goldene Regel lautet: Welche Zeitform unterstützt am besten die Geschichte, die ich erzählen will?
Diese Erkenntnis hat praktische Konsequenzen für jeden, der schreibt. Wer eine Geschichte im Präteritum erzählt, muss sich bewusst sein, dass er damit nicht automatisch über Vergangenes berichtet, sondern eine spezifische Erzählhaltung einnimmt. Das erzählerische Präteritum ermöglicht es, gleichzeitig nah und distanziert zu erzählen – nah genug, um die Leser mitzunehmen, distanziert genug, um die nötige epische Übersicht zu behalten.
Vergleichen wir zwei Satzanfänge: »Ich gehe zum Bahnhof« (Präsens) versus »Ich ging zum Bahnhof« (Präteritum in der Prosa). Der erste klingt nach Tagebuch oder direkter Rede, der zweite nach Erzählung. Beide können sich auf denselben Moment beziehen, aber das Präteritum schafft jene epische Distanz, die es dem Erzähler ermöglicht, mehr zu wissen und zu verstehen, als der Protagonist im Moment selbst weiß.
Und selbst was im Deutschaufsatz ein Fehler wäre, ist im Roman erlaubt: der unmittelbare und temporäre Wechsel vom Präteritum zum Präsens, um die Gegenwärtigkeit zu steigern: »Er ging die Straße entlang und dachte nach. Da rast ein Auto auf ihn zu, und er hechtet in den nächsten Vorgarten. Die Nachbarin beobachtete es aus dem Fenster.«
In der Lyrik hingegen sollte die Tempuswahl bewusster getroffen werden. Ein Präteritum signalisiert hier oft echte Vergangenheit, Erinnerung, Abstand. Ein Präsens dagegen Unmittelbarkeit, Präsenz, direkte Erfahrung. Brechts »Erinnerung an die Marie A.« nutzt bewusst das Präteritum der Erinnerung: »An jenem Tag im blauen Mond September« – hier ist die Vergangenheit wirklich vergangen.
Die Kunst der zeitlichen Täuschung
Das erzählerische Präteritum ist letztendlich eine der elegantesten Erfindungen der deutschen Sprache. Es ermöglicht eine Art zeitliche Täuschung: Wir lesen über etwas, das sprachlich vergangen ist, aber erzählerisch gegenwärtig bleibt. Diese Doppelung macht die besondere Magie des Erzählens aus – die Fähigkeit, gleichzeitig hier und dort, jetzt und damals zu sein.
Rilkes »Herbsttag« demonstriert diese Zeitkunst exemplarisch: Das Gedicht beginnt mit dem Präsens (»Herr, es ist Zeit«), wechselt zum erinnernden Präteritum (»Der Sommer war sehr groß«) und mündet schließlich ins unmittelbare »Jetzt« (»Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr«). In wenigen Zeilen durchmisst es die ganze Bandbreite temporaler Möglichkeiten – von der direkten Ansprache über die Erinnerung bis zur existenziellen Gegenwart.
Wolfgang Tischer


Das ist/war ja ein schöner und erhellender Artikel, vielen Dank ?
Interessanter Beitrag, gut geschrieben, mit anschaulichen Beispielen. Vielen Dank!
Sehr schöner Artikel!
Danke, großartig!
Ein klarer und aufschlussreicher Artikel.
Vielen Dank für den Artikel. Jetzt habe ich einiges besser verstanden und kann meine eigene Erzählweise diesbezüglich analysieren.
Erzählerisches Präteritum oder erlebter Präsens? Oder beide? Danke für diesen Beitrag, er wird mir fürs nächste Buch eine Unterstützung sein.
Bravo, gut dargestellt, Wolfgang!
Ein Genuss und sehr erhellend, danke!
Vielen Dank für diesen guten Beitrag. Jetzt habe ich endlich verstanden, weshalb mich Romane im Präsens so irritieren.
Was für ein außergewöhnlich lesenswerter Artikel.
Ich bin ehrlich begeistert.
Aufschlussreich und spannend zu lesen, mit wunderbaren Beispielen.
Zukünftig werde ich viel bewusster über die gewählte Zeitform reflektieren, – sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben ( Letzteres bisher oft eher intuitiv ?? ).
,, . . . Danach wird die Zeit für Sie anders vergehen. . . . “
Auf jeden Fall bedachter .
Danke für diese Inspiration.
Danke sehr. Da ich Prosa und Lyrik schreibe, ist der Artikel für mich sehr anregend, wieder bewusster mit meiner Muttersprache umzugehen.
Vielen Dank! Sehr erhellend.
Danke für den aufschlussreichen Artikel!
Bei Kinderliteratur wird jedoch mehr das Präsens verwendet. Zumindest für die Kleinen. Gibt es hierzu auch Anmerkungen?
Mit literarischen Grüßen
Birgit Gröget